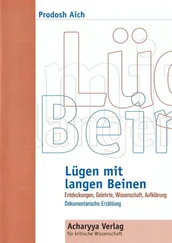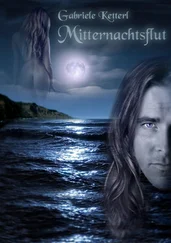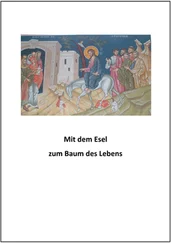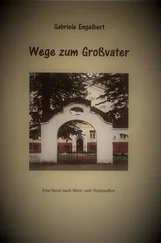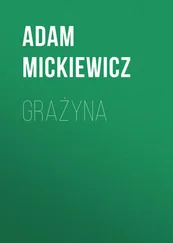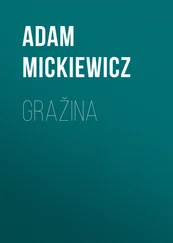Sie wachsen in Slums auf, ohne Wasser, Strom oder die einfachsten hygienischen Voraussetzungen, ohne ärztliche Versorgung, ohne Schule.
Auf Müllhalden und von Müllhalden leben diese Menschen, trotz bestialischem Gestank. Nicht einmal die unzähligen Ratten überleben hier länger, sie ersticken an den austretenden Gasen. Straßenkinder aber wühlen nach Brauchbarem im Unrat. Hier vegetieren Menschen, Kinder ohne Hoffnung und Lebensperspektive. Dieses Wühlen im Müll ist lebensbedrohlich: Bronchitis, Hautausschläge, Darmerkrankungen sind die Folge. Medikamente sind unerschwinglicher Luxus. Um die täglichen Verletzungen, auf den Müllhalden entstanden, wickelt man einen schmutzigen Lappen, denn Wasser gibt es meist nicht oder nur stundenweise und es ist teuer. Ohne Geld ist auch das ein unbezahlbarer Luxusartikel.
Und zwei Jahre später
Was wir zwei Jahre später in einer anmutenden Anti-Adoptionskampagne in allen Zeitungen lasen, war unglaublich:
„Kinderhandel mit der Dritten Welt: Adoption auf Bestellung“ „Kinder in Lima für 12.000 Mark verkauft“ „Werden wohlhabende Leute kriminell, um ein Kind zu bekommen? Wissen die denn, was sie tun?“ Eine andere Zeitung schrieb: „Das ,kleine Schwarze‘ ist groß in Mode. Tausende kinderlose Ehepaare in Deutschland, Holland und Schweden kaufen sich Kinder in Asien oder Lateinamerika. Holländische Agenturen machen das große Geschäft mit organisierten Baby-Touren auf der Tropeninsel in Sri Lanka …“
Meine Sammlung dazu wuchs erschreckend und fühlte sich für uns auch wie eine persönliche Bedrohung an.
Zahlreiche Adoptiveltern reagierten in Leserbriefen darauf. Auch wir. Die Stuttgarter Nachrichten berichteten über das „Kinderkriegen als bürokratischer Akt“ und veröffentlichten meinen Leserbrief „Kinder aus der Dritten Welt“ am 11. Mai 1982.
Später würde in einem Bericht des Jugendamtes Esslingen zu lesen sein: … „Im Jahr 1983 wurden sechs Auslandsadoptionen und zwei Kinder an Pflegeeltern vermittelt. Diesen neun Adoptionen stehen 82 gemeldete adoptionswilligen Ehepaare gegenüber.“
Und wie reagierten unsere Freunde und Familien? Mit diesem Vorhaben wurden wir als leicht „verrückt“ abgestempelt. „Ausländer bei uns? Was wird später aus diesen Kindern? So Ausländer-freundlich ist Deutschland nun auch wieder nicht! Tolerant sind wir mit dem Mund, aber weniger mit unserem Herzen.“ Aber auch: „Wir begleiten und unterstützen euch auf diesem langen, schwierigen Weg und wünschen euch viel Glück, Kraft, Mut und Durchhaltevermögen. Ihr schafft das schon.“
Am 26. Juni 1980 - Im Land der Inkas
An diesem Tag begann die Geschichte eines winzigen Lebens, viele Tausend Kilometer von uns entfernt, in Südamerika, in Peru, im Land der Inka. Was an diesem und den folgenden Tagen und Wochen geschah, erfuhren wir später durch unseren Rechtsanwalt in Lima und die mich begleitende und betreuende Dolmetscherin.
Lima/Peru - am 26. Juni 1980
Eine Indiofrau, Maxima Rosario, ihr Alter wurde im Armenhospital mit 22 Jahren angegeben, sie kannte ihr genaues Geburtsdatum nicht. Hochschwanger machte sie sich in ihrer traditionellen, bunt gewebten Indiotracht, ihrem weit schwingenden Rock, ein bunt gewebtes Tuch über die Schulter gewunden, schweren und langsamen Schrittes, vorgebeugt unter der Last des Kindes, das auf die Welt drängte, auf den Weg ins Armenhospital in Lima. Dort würde sie einem Kind das Leben geben, für das sie nichts hatte. Nichts als die nackte Armut in einer winzigen, windschiefen Bretterhütte mit einer Tür. Ohne Fenster und mit einem Wellblechdach, auf das der Winterregen in Lima trommelt. Der graue Lima-Nebel lag bleischwer über der Stadt. Das Thermometer zeigte acht Grad an. Limawinter. Sie verdiente als Wäscherin ein paar Centavos und mit viel Glück auch ein paar Soles. Diese reichten für die sechs hungrigen Mäuler nicht aus. Ihr Mann hatte sich irgendwann einmal aus dem Staub gemacht.
Eigentlich lebte sie mehrere Tagesreisen von Lima entfernt, im Hochland der Anden auf etwa 3.000 m Höhe. Heute arbeitet Maxima Rosario an der Küste in Perus Hauptstadt Lima, begrenzt durch die Anden, dem mächtigsten Faltengebirge der Welt, mit seiner Gebirgslänge von 7.300 km, das den ganzen Kontinent durchzieht und begleitet.
Ihre Familie hingegen lebt im Hochland, dem Altiplano mit seinen schroffen Höhenzügen und Gletschervulkanen. Diese Hochtäler liegen 2.300 bis 3.800 m hoch. Hier leben die meisten Indiobauern, die Quechua und bauen Mais, Weizen, Gerste und Kartoffeln an. Maxima Rosarios Familie gehört zum Stamme der Quechua.
Das kleine Indiodorf auf dem Altiplano, dem kargen Hochland der Anden, ernährt die Familie mehr recht als schlecht. Sie leben von den wenigen Alpakas, dem Lasttier der Anden und den Schafen, die sie züchten und die sie auf dem Indiomarkt verkaufen. In dieser Höhe ist das Land karg, die Luft dünn und das Leben schwer.
Ihre Nachbarn besitzen noch zottige, braune Lamas und Guanakos als Lastentiere und Lieferanten für Fleisch und Wolle. Manche besitzen Schweine und in tieferen Lagen Rinder, die die spanischen Eroberer mitbrachten. Fast alle Indios halten sich als Haustiere Meerschweinchen, die gegessen werden.
Hoch über ihnen in der Luft gleitet der Kondor, der Herr des Hochgebirges, der schwerste fliegende Vogel mit einem Körpergewicht von bis zu zwölf Kilo und einer Flügelspannweite von bis zu drei Metern, ruhig und majestätisch über die Geröllfelder, Gletscher und das braune Land des Altiplano dahin. Der braune Boden ist karg und die kleinen Lehmhäuser mit den mit Schilf gedeckten Dächern ducken sich hinter braune Lehmmauern. Die Großmutter sitzt mit ihrem Wetter gegerbten braunen Gesicht und unzähligen tief eingegrabenen feinen Falten alterslos erscheinend, mit hervorgetretenen Backenknochen in der wärmenden Nachmittagssonne. Die Spindel zum Wollespinnen in den ruhelosen braunen Händen.
Viele Indios tragen Trachten, die von Region zu Region sehr unterschiedlich sind. Die Stoffe werden mit traditionellen Farben und Indiomustern aus Schaf- oder Alpakawolle selbst gewebt. Die Motive sind der Natur entnommen: Vögel, Pflanzen, der Kondor, das Lama, die doppelköpfige Schlange, die Sonne. Über die weit schwingenden Röcke wird eine farbenfrohe Bluse getragen. Ein Hut krönt das Ganze. Die Männer tragen über den Hemden quadratische Ponchos, einen Hut oder eine gestrickte Mütze.
Jeder in der Familie hat seine festgelegte Aufgabe: Holz organisieren, die Tiere versorgen, den Boden mühsam bestellen, Süßkartoffeln und Mais ernten, aus der gesponnen Schafs- und Alpakawolle leuchtende Teppiche und Tücher zu Umhängen weben, um diese zu verkaufen. Hier ist Maxima Rosario zu Hause. Sie hat wie alle Indios eine enge Bindung zur Familie und zur Mutter Erde.
Als Maxima Rosario noch klein war, wurde sie von ihrer Mutter auf dem Rücken getragen, eingehüllt in ein bunt gewebtes Stofftuch. Sie war in den Tagesablauf eingebunden, spürte die Sonne, den Regen, die Kälte und erfuhr jede Bewegung der Mutter hautnah. Sobald sie laufen konnte, trippelte sie neben der Mutter her, begleitete sie beim Kochen am Lehmherd und leistete ihr Gesellschaft bei der Feldarbeit, beim Weben, Wolle spinnen oder Schafe hüten. Mit drei Jahren durfte sie schon selbst auf die Tiere aufpassen, sie half im Haushalt mit und Maxima Rosario erlebte Arbeit in der Familiengemeinschaft.
Eine Spielwelt kannte sie nicht, sie war damit beschäftigt, Menschen, Tiere und die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu entdecken. Sie lernte, wie Erde riecht, wie man sät oder erntet, wie man miteinander spricht und isst.
Als sie in die Schule kam, war der Schulweg lang und weit. Vor und nach dem Unterricht erledigte Maxima Rosario die ihr aufgetragenen häuslichen Pflichten. Sie kümmerte sich um die kleineren Geschwister, trug sie in ihrem bunten Tragetuch, half der Mutter Dinge herzustellen, die auf dem Sonntagsmarkt verkauft werden konnten, bewässerte den Garten, lernte Stoffe zu weben, um daraus Bekleidung zu nähen oder Töpfe aus Ton herzustellen. Sie wurde größer, entdeckte ihre Umwelt, half der Mutter auf dem Markt ihre Waren zu verkaufen und lernte, wie man mit Geld umgeht und eine geübte Verkäuferin wird. Sie erfuhr etwas über Arbeit und Feilschen, über Streit, über die Überheblichkeit der Städter sowie die Solidarität ihrer Großfamilie und der Dorfgemeinschaft.
Читать дальше