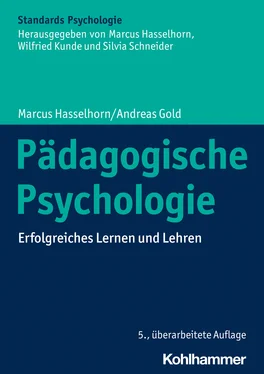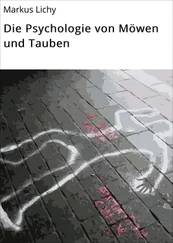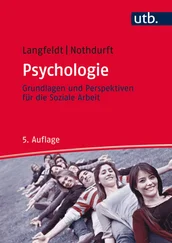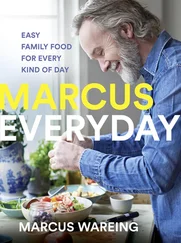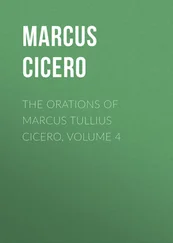Während wir kognitive und motivationale Prozesse in den vorangehenden Abschnitten dieses Kapitels bereits kennengelernt haben, war von emotionalen Prozessen bisher noch nicht die Rede. Dies wird am Ende dieses Kapitels nachgeholt mit einer kurzen Skizze der bei Lernleistungen relevanten Emotionen. Zunächst führen wir aus, worin die volitionalen Probleme beim Lernen bestehen können, welche Handlungskontrollfunktionen durch volitionale Prozesse erfüllt werden und welche stabilen interindividuellen Differenzen (volitionale Stile) dabei zu beachten sind.
In der Willenspsychologie werden vor allem drei Arten von Volitionsproblemen unterschieden (Heckhausen, 1989): die Initiierung einer Handlung, ihre Persistenz und, damit eng verknüpft, die Überwindung von Handlungshindernissen. Viele Motivationstheorien gehen implizit davon aus, dass eine Handlung automatisch initiiert wird, wenn nur eine hinreichend starke Motivationstendenz entstanden ist. Häufig ist dies jedoch nicht der Fall, da erst der »richtige Zeitpunkt« zur Realisierung einer eigenen Absicht kommen muss. Motivationstendenzen erhöhen allerdings die Bereitschaft, eine beabsichtigte Handlung auszuführen.
Beispiel: Handlungsinitiierung
Ein durchaus begabter Schüler hat in den letzten Monaten in seinen schulischen Leistungen so deutlich nachgelassen, dass seine Versetzung gefährdet ist. Nach einem klärenden Gespräch mit seinen Eltern entscheidet er sich, die Rückstände in den besonders kritischen Fächern systematisch aufzuarbeiten. Er lässt sich von den Lehrern einen Stoffplan aufstellen und nimmt sich vor, diesen Plan abzuarbeiten. Aber die Nachmittage vergehen, ohne dass er in sein Lernprogramm einsteigt. Irgendwie »steht er sich auf dem Fuß«; es gibt immer irgendwelche Umstände, warum es jetzt gerade nicht gut passt und der Beginn immer wieder verschoben wird. Die Initiierung der ersten Lernschritte, um den Entschluss umzusetzen, wird zum Problem.
Ist die Handlungsinitiierung gelungen, indem beispielsweise der Einstieg in einen komplexen Lernprozess vollzogen wurde, können jedoch weitere volitionale Probleme hinzukommen: Vor allem muss die Handlungstendenz andauern, d. h. sie muss so lange das Handeln leiten, bis das Ziel einer Handlung erreicht ist. In dem oben skizzierten Beispiel wird das Erreichen des Lernzieles vermutlich Wochen oder gar Monate in Anspruch nehmen. In dieser Zeit wird der betroffene Schüler immer wieder neue Probleme der Handlungsinitiierung erleben, wenn es darum geht, einen nächsten Lernschritt zu realisieren. Auch werden sich Hindernisse unterschiedlichster Art auftun (z. B. Ärger, dass ein intensiv bearbeiteter Sachverhalt doch nicht verstanden wurde; Einladung zum Kinobesuch), um eine initiierte Handlungstendenz zu blockieren. Lernende unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, einmal gefasste Lernentschlüsse gegen konkurrierende Handlungsimpulse abzuschirmen und Persistenz im Lernverhalten zu zeigen (»Warum sitze ich eigentlich hier und lerne, wenn ich doch nichts verstehe?«).
Auf einer ersten Stufe besteht Persistenz nur in der Fähigkeit einer unerledigten Handlungstendenz, sich wieder zu melden, wenn die Situation die Aufmerksamkeit nicht anderweitig in Beschlag nimmt und wenn keine andere Handlungstendenz stärker ist. Höhere Anforderungen an Persistenz werden erfüllt, wenn die unerledigte Handlungstendenz die Anregungswirkung starker Stimuli der umgebenden Situation ausblenden kann. Diese Persistenz auf zweiter Stufe könnte noch von einer Persistenz auf dritter Stufe übertroffen werden, wenn es gelänge, einer Handlungstendenz selbst gegen konkurrierende Handlungstendenzen von größerer Stärke zeitweiligen Vorrang zu geben. (Heckhausen, 1989, S. 192)
Volition als Handlungskontrolle
Die Frage, wie es gelingen kann, Handlungsabsichten tatsächlich zu realisieren, zielführende Handlungen zu beginnen und sie allen konkurrierenden Handlungsimpulsen zum Trotz bis zur Zielerreichung andauern zu lassen, ist Gegenstand von Theorien der Selbstregulation bzw. der Handlungskontrolle. Kanfer (1996) hat in seinem Selbstregulationsmodell die Schritte eines selbstregulativen Zyklus am Beispiel des Auftretens von Handlungshindernissen folgendermaßen beschrieben: Wenn es zur Unterbrechung einer Lernhandlung gekommen ist, so wird die Situation (1) zunächst daraufhin beurteilt, ob sie überhaupt noch unter der Kontrolle des Handelnden steht. Ist dies nicht mehr der Fall, wird der Selbstregulationsprozess abgebrochen. Erscheint die Situation hingegen als prinzipiell kontrollierbar, so wird (2) geprüft, ob es sich bei dem aufgetretenen Hindernis um ein wichtiges Anliegen der Person handelt. Ist das der Fall, dann kommt es (3) zu einer Prüfung des erreichten Standes der unterbrochenen Handlung. Dabei wird die Diskrepanz zum Handlungsziel festgestellt und es wird geprüft, inwieweit man sich selbst in der Lage sieht, diese Diskrepanz durch fortgesetzte Handlungen zu verringern. Sieht man die Möglichkeit, die Diskrepanz durch eigenes Tun merklich verringern zu können, werden (4) die notwendigen Bewältigungstätigkeiten initiiert. Bei großer wahrgenommenen Diskrepanz und geringer Kompetenzüberzeugung, diese durch eigenes Tun merklich verringern zu können, wird der Zyklus der Selbstregulation allerdings abgebrochen.
Eine eher funktionale Klassifikation der unterschiedlichen Prozesse der volitionalen Handlungskontrolle stammt von Julius Kuhl (1987, 1996). Kuhl unterscheidet sechs Arten von Strategien, die ein Lernender mit günstigen volitionalen Voraussetzungen einsetzt, wenn sich innere oder äußere Hindernisse der Absichtsrealisierung in den Weg stellen oder wenn die der Handlungsabsicht zugrunde liegende Motivation zu schwach ist und gegen andere, stärkere Tendenzen abgeschirmt werden soll.
Fokus: Strategien der Handlungskontrolle (nach Kuhl, 1996)
1. Aufmerksamkeitskontrolle: Ausblenden von Informationen, die absichtswidrige Motivationstendenzen stärken.
2. Enkodierungskontrolle: Fokussieren der Verarbeitungsfunktionen auf zielrelevante Informationen.
3. Motivationskontrolle: Steigerung der eigenen Motivation, die beabsichtigte Handlung auszuführen.
4. Emotionskontrolle: Beeinflussung eigener Gefühlslagen zur Steigerung der Handlungseffizienz.
5. Misserfolgs- bzw. Aktivierungskontrolle: Unterbinden von Tendenzen, einem Misserfolg lange in Gedanken nachzuhängen und Abstandnehmen von unerreichbaren Zielen.
6. Initiierungskontrolle: Vermeiden übermäßig langen Abwägens von Handlungsalternativen.
Die Anwendung solcher Handlungskontrollstrategien ist hilfreich, aber nicht einfach. Leicht vorstellbar ist, dass es zu mancherlei »Störungen« der Handlungskontrolle kommen kann. Versagt etwa die Emotionskontrolle, dann kann es dazu kommen, dass etwa ein Gefühl der Verärgerung über eine Bemerkung eines Lehrers oder auch ein lähmendes Gefühl, das sich nach einer unangenehmen Nachricht einstellt, nachfolgend zu einer fortgesetzten Unaufmerksamkeit im Unterricht führt, obwohl eigentlich die Absicht bestand, heute besonders gut aufzupassen.
Aus Alltagsbeobachtungen gewinnt man bisweilen den Eindruck, dass sich Menschen systematisch in der Art und Weise unterscheiden, wie sie mit Störungen bei der Umsetzung beabsichtigter Handlungen umgehen. Die Niedergeschlagenheit, die eine unangenehme Nachricht auslösen kann, beeinträchtigt das Lernverhalten der einen Person nur für wenige Stunden, das einer anderen aber für Tage und Wochen. Bei ihr hält das lähmende Gefühl fortwährend an, so dass sie nur noch über ihre missliche Lage nachdenken kann und ihr jeglicher Schwung fehlt, sich auf die neu anstehenden Lernaufgaben zu konzentrieren. Kuhl (1981) hat aufgrund von Beobachtungen dieser Art auf stabile Persönlichkeitsunterschiede in der Herangehensweise an beabsichtigte Handlungen geschlossen. Er unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen lageorientierten und handlungsorientierten Personen.
Читать дальше