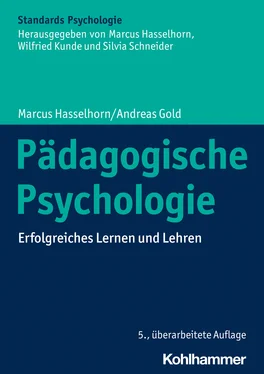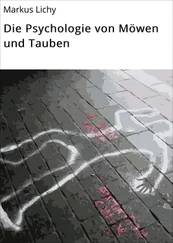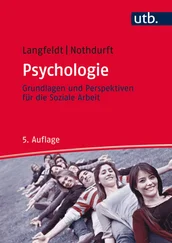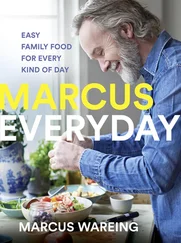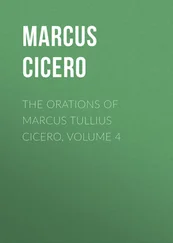Fokus: Selbstkonzept als Wertkomponente in der Erwartungs-mal-Wert-Theorie von Eccles und Wigfield (2020)
Die Trennung in eine Kompetenz- und Affektdimension akademischen Selbstkonzepts entspricht auch der oben beschriebenen sehr verbreiteten Weiterentwicklung des Risiko-Wahl-Modells durch Eccles und Wigfield (2020). Hier wird die schulische Motivation in eine Erwartungs- und in eine Wertkomponente unterteilt. Die Erwartungskomponente beinhaltet Selbstwahrnehmungen eigener Fähigkeiten und Erfolgserwartungen und wird in empirischen Untersuchungen entsprechend häufig durch das akademische Selbstkonzept erfasst. Die Wertkomponente bildet den Anreizaspekt von Tätigkeiten ab und kann ihrerseits in vier Unterfacetten aufgeteilt werden: intrinische Motivation (Freude, Interesse), Nützlichkeit (Passung zu zukünftigen Plänen und Zielen der eigenen Person), Relevanz (subjektive Bedeutsamkeit guter Leistungen und Erfolge für die eigene Person) und Kosten (die zu investierende Anstrengung und die Opportunitätskosten).
Für die Genese des akademischen Selbstkonzepts sind vor allem Leistungsrückmeldungen signifikanter Anderer (z. B. von Lehrpersonen) sowie soziale und dimensionale Vergleiche bedeutsam. So vergleichen Kinder und Jugendliche ihre eigenen Fähigkeiten und Leistungen nicht nur mit denen der Anderen (sozialer Vergleich), sondern sie vergleichen auch ihre eigenen Leistungen in den verschiedenen Lernbereichen miteinander, z. B. ihre Leistungen in den sprachlichen mit ihren Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern (dimensionaler Vergleich).
Fokus: Das Modell des »Internal vs. External Frame of Reference« (I/E-Modell)
Das I/E-Modell von Marsh (1990) erklärt, wie es zur Ausdifferenzierung des akademischen Selbstkonzepts in einen mathematischen und verbalen Bereich kommt. Grundlage ist das Zusammenspiel von zwei simultan ablaufenden Vergleichsprozessen. In einem sozialen (externalen) Vergleich vergleichen Schülerinnen und Schüler ihre eigenen fachlichen Leistungen mit den Leistungen der anderen ihrer Klasse im gleichen Fach. Da Schülerinnen und Schüler, die gut in Deutsch sind, oft auch gut in Mathematik sind, sollte der soziale Vergleichsprozess dazu führen, dass diejenigen mit einem positiven verbalen Selbstkonzept auch über ein eher positives mathematisches Selbstkonzept verfügen. Wenn diese Annahme stimmt, sollte es also positive Korrelationen zwischen dem verbalen und dem mathematischen Selbstkonzept geben.
Die Empirie sieht jedoch anders aus. Zumeist finden sich keine bedeutsamen Korrelationen zwischen dem verbalen und dem mathematischen Selbstkonzept. Verantwortlich ist dafür ein zweiter Vergleichsprozess. Beim dimensionalen (internalen) Vergleich werden die eigenen Leistungen in einem Fach den eigenen Leistungen in einem anderen Fach gegenübergestellt. Dieser Vergleichsprozess bewirkt einen Kontrasteffekt, wodurch das Selbstkonzept für den akademischen Bereich gestärkt wird, für den die individuell besten Leistungen wahrgenommen werden. Nimmt ein Schüler z. B. wahr, dass er besser in Mathematik ist als in Deutsch, so wird sein mathematisches Selbstkonzept gestärkt, sein verbales Selbstkonzept jedoch geschwächt. Somit führt der dimensionale Vergleich am Ende dazu, dass es zu einem negativen Zusammenhang zwischen dem mathematischen und verbalen Selbstkonzept kommt. Durch das Zusammenspiel des externalen und des internalen Vergleichsprozesses kommt es letztlich zu einer Unabhängigkeit des mathematischen vom verbalen Selbstkonzept, da sich der positive Zusammenhang nach dem sozialen Vergleichsprozess und der negative Zusammenhang nach dem dimensionalen Vergleichsprozess ausgleichen.
Das Zusammenspiel von sozialen und dimensionalen Vergleichsprozessen erklärt auch die Bereichsspezifität des Einflusses der Schulleistung auf das Selbstkonzept (Marsh & Craven, 2006). So konnte gezeigt werden, dass gute Mathematikleistungen sich positiv auf das Selbstkonzept in Mathematik, aber negativ auf das verbale Selbstkonzept auswirken. Ebenso beeinflussen gute verbale Leistungen das verbale Selbstkonzept positiv, das mathematische Selbstkonzept jedoch negativ. Der positive Einfluss von Leistung auf das Selbstkonzept innerhalb eines Inhaltsbereichs lässt sich auf den vom I/E-Modell angenommenen sozialen Vergleichsprozess zurückführen, während der negative Einfluss auf das Selbstkonzept in anderen Inhaltsbereichen durch den dimensionalen Vergleichsprozess bedingt zu sein scheint.
Das I/E Modell hat die Forschung zu dimensionalen Vergleichen vorangetrieben und zu einer Theorie dimensionaler Vergleiche geführt, die sich mit den Determinanten und Auswirkungen dimensionaler Vergleiche befasst. In diesem Zuge wurde das »Generalized Internal/External Frame of Reference« (GI/E) Modell entworfen (Möller, Müller-Kalthoff, Helm, Nagy & Marsh, 2016). In diesem Modell wird das klassische I/E-Modell weiterentwickelt: Nun wird berücksichtigt, dass nicht nur Leistungen Gegenstand dimensionaler Vergleiche sein können und dass sich dimensionale Vergleiche nicht nur auf Selbstkonzepte, sondern auch auf andere motivationale und emotionale Merkmale auswirken können. Auch wird die im klassischen I/E-Modell fokussierte Kontrastierung zwischen dem mathematischen und verbalen Bereich durch die Hinzunahme weiterer Schulfächer ergänzt. Wolff et al. (2019) haben zusätzlich das Zusammenspiel sozialer und dimensionaler Vergleiche um das Wirken temporaler Vergleiche (Vergleich der eigenen aktuellen Leistungen mit eigenen früheren Leistungen) ergänzt.
Für den individuellen Lernerfolg ist das Selbstkonzept von hoher Relevanz. Dies belegt vor allem der empirisch gesicherte Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und schulischer Leistung (Guay, Ratelle, Roy & Litalien, 2010; Marsh & Craven, 2006). Für die Erklärung des Zusammenhangs von Selbstkonzept und Leistung findet man zwei gegensätzliche theoretische Erklärungsansätze. Nach dem Self-Enhancement-Ansatz stellt das Selbstkonzept eine Determinante der schulischen Leistung dar, während der Skill-Development-Ansatz davon ausgeht, dass es die schulische Leistung ist, die das Selbstkonzept beeinflusst (Guay, Marsh & Boivin, 2003). Die Unterscheidung dieser beiden Ansätze ist nicht nur von theoretischer, sondern auch von praktischer Relevanz. So geht der Self-Enhancement-Ansatz davon aus, dass sich eine Verbesserung des Selbstkonzepts direkt in einer Verbesserung des individuellen Lernzuwachses niederschlägt (Haney & Durlak, 1998). Von einer gezielten Förderung des Selbstkonzepts wären demnach positive Effekte auf die schulische Entwicklung zu erwarten. Auf der Grundlage des Skill-Development-Ansatzes wäre aufgrund der hypothetisch gegenteiligen Wirkrichtung die pädagogische Konsequenz jedoch eine andere. Da beide Ansätze in der Literatur vielfach Untermauerung gefunden haben (Valentine, DuBois & Cooper, 2004), wird mittlerweile davon ausgegangen, dass sowohl die schulische Leistung einen Einfluss auf das Selbstkonzept ausübt, als auch das Selbstkonzept die Leistungsentwicklung beeinflusst (Wu, Guo, Yang, Zhao & Guo, 2021).
Studie: Ist der Entwicklungszusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung tatsächlich reziprok?
Die vielen empirischen Bestätigungen einer bidirektionalen Beziehung zwischen Selbstkonzept und Leistung basieren zumeist auf Variationen des klassischen Cross-Lagged-Panel-Modells. Anhand eines Längsschnittdatensatzes mit mehr als 2.000 Grundschulkindern, von denen zwischen Ende der 1. und Mitte der 4. Klasse das Lese-Selbstkonzept und die Leseleistung erhoben wurden, prüften Ehm, Hasselhorn und Schmiedek (2019) den Entwicklungszusammenhang zwischen Selbstkonzept und Leistung mit einer Reihe neuerer statistischer Modelle, etwa dem Random-Intercept Cross-Lagged Panel Model. Es ergaben sich deutliche Unterschiede in den Ergebnissen in Abhängigkeit davon, ob die klassische oder eine neuere Analysemethode gewählt wurde. Während Effekte von der Leistung auf das Selbstkonzept in allen Modellierungen nachgewiesen werden konnten, fand sich für den umgekehrten Effekt unter Anwendung der neueren statistischen Modelle kaum Evidenz. Übereinstimmend damit kommen Wu et al. (2021) in ihrer Metaanlyse zu der Schlussfolgerung, dass im Grundschulalter wohl vor allem der Skill-Development-Ansatz zutreffend sein sollte und dass die Annahme des reziproken Wirkzusammenhangs erst für ältere Jahrgangsstufen gültig ist.
Читать дальше