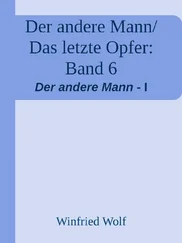Drittes Kapitel 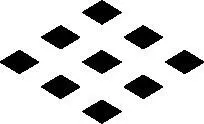 Worin Jens in einem noblen Forschungszentrum spioniert und mehr findet, als er gesucht hat
Worin Jens in einem noblen Forschungszentrum spioniert und mehr findet, als er gesucht hat
Als Jens Deschwitz am Nachmittag desselben Tages den U- Bahnhof am Rotkreuzplatz verließ, regnete es. Sein rechter Schuh war nicht mehr ganz wasserdicht, aber er war nicht zimperlich. »Aschermittwoch muss wohl grau sein wie Asche«, dachte er. Als Fotograf liebte er nassen Asphalt, regenverschleierte Hintergründe, Schatten ohne Sonne. Nach vier Jahren als Industriefotograf in Bitterfeld und Zwickau war er 1991 arbeitslos geworden. Die nächsten Jahre hatte er sich als freier Mitarbeiter in Werbeagenturen versucht. Dabei bildete sich seine fotografische Handschrift aus, die Liebe zu den Zwischentönen. So lichtete er die neuen Westprodukte in Nieselregen, Nebel, nächtlicher Dämmerung oder unter moosigen Brückenbögen ab. Anfangs mit nicht wenig Erfolg. »Wir Ossis können uns noch nicht der prallen Sonne des Wohlstands aussetzen«, begründete er, ganz Philosoph, seine ungewöhnliche Vorgehensweise. Die Ergebnisse gaben ihm recht. Knallgelb wurde kastanienbraun, aufreizendes Rot ein samtenes Bordeaux. Eben ohne die schreienden Farben, die man im Westen aus Werbung, Schaufenstern und Verpackung gewohnt war. Ein Bremer Galerist war auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihm eine Ausstellung organisiert. Drei Feuilletons hatten eine Randnotiz dazu gebracht, ein Kulturkanal hatte ein zwanzigsekündiges Interview gesendet, doch das war es auch schon gewesen. Ein bloßer Moment des Erfolgs, wirklich keine pralle Sonne. Bald gingen die Aufträge zurück. Er arbeitete einfach zu langsam und war miserabel in der Selbstvermarktung. Andere hatten seine Art imitiert, nur viel effizienter. Immerhin hatte diese Periode ihm einen gewissen Namen als kreativer Sonderling eingebracht.
Danach stieß Jens für einige Jahre mit Bewerbungsfotos für gehobene Ansprüche auf eine Goldader. Seine einzige Schwäche: Mitgefühl. Am meisten taten ihm die Fünfzigjährigen leid. Von ihren missglückten Posen vor der Kamera hatte er bald ein Album voll mit Ausschuss. Angestrengt hatten all diese Wende-Verlierer sich bemüht, ein Gewinner-Lächeln aufzusetzen. »American smile«, nannte er diese Sammlung. Aus seiner Langsamkeit bei den Regenbildern hatte er zwar seine Lehren gezogen und lieferte seinen Kunden nun pünktlich perfekte Fotos ab. Doch zur gleichen Zeit entwickelte Jens eine Passion für »das wahre Antlitz eines Menschen« – einen Halbsatz lang konnte er schon einmal richtig feierlich werden. Dabei experimentierte er. Zuerst führte er seine Kamera extrem nahe an die Gesichter heran, entwickelte eine eigene Beleuchtungstechnik, vor der sich kein Quadratzentimeter Haut verstecken konnte, und suchte eine Scharfeinstellung, die sich auf die problematischen Gesichtspartien konzentrierte und auf diese Weise unwiderlegbar jeden falschen Schein dieser Person entlarvte. Fettige Poren, Pickelnarben, ein Schnitt infolge einer zu hastigen Rasur, eine Krümmung der Nase, ein Hautfetzen an der Lippe und dann natürlich die Augen – die Lider zu weit aufgerissen, blinzelnd, zusammengekniffen, erschreckt wandernde Pupillen, gerötete Bindehaut, querliegende Wimpernhärchen, Sandmännchens Mitbringsel, ein Gerstenkorn oder natürlich Augenringe in jeder Größe. »Du bist ja ein Protestant ohne Taufe«, meinte ein Kollege zu ihm. »So wenig duldest du Lügen, und dabei ruhst du nicht, bis du jeden Makel bei einem Menschen entdeckt hast.« Diese Bemerkung hatte ihn geärgert, gerade weil sie zur Hälfte zutraf. Lug und Trug, aufgesetztes Gebaren und Schauspielerei hasste er nicht erst, seitdem sie Westen waren. In diesem Punkt würde er niemals über seinen Schatten springen, und damit hatte er sein Schicksal selbst besiegelt. In der neuen Zeit würde er immer nur in irgendwelchen Nischen überleben können. Das wahre Antlitz eines Menschen, schön muss es sein, damit sich der Blick nicht von ihm abwendet – das zu wissen war er Fotograf genug. Nur Makel zeigen und sonst nichts, das wäre ekelig. Jens lernte Barmherzigkeit und veränderte seine Technik. »The line of grace and beauty«, diesen Ausdruck hatte er irgendwo gelesen, und so forschte er fortan nach der Gesichtspartie, die jemanden unverwechselbar machte, oder besser … liebenswert. Irgendwann war dann aber Kassensturz: Von der Portraitfotografie allein konnte er unmöglich leben. Seine Suche nach dem Stein der Weisen darin war ohnehin nur brotlose Kunst. So begann er 1998 als freier Bildjournalist, neben den Portraits seine Haupteinnahmequelle bis heute.
Als Jens den U-Bahnhof verließ, regnete es also. Dennoch ging er zu Fuß weiter zum Nymphenburger Schloss, immer den Kanal entlang. Südliche oder Nördliche Auffahrtsallee? Der Norden lag ihm schon immer näher. Das graugrüne Wasser verriet nicht, ob es stand oder floss. Links und rechts davon mehrten sich die Villen. Allein die Steigerung des Marktwertes in den letzten Jahren von einer von ihnen hätte mir genügt, mir mein Traumstudio zuhause leisten zu können, tropfte ihm ein Gedanke ins Bewusstsein, zerplatzte aber gleich darauf schon wieder. Er war nicht neidisch. Vielleicht hatte diesen Gedanken nur das schlechte Gewissen darüber ausgelöst, dass er die Bilder der fünf Toten an Jack verkauft hatte.
Jetzt gab der Weg entlang des Kanals den Blick auf das weit ausgreifende Areal des Schlosses frei. Der langgezogene Strich des Wassers verbreiterte sich vasenartig zu einem Teich, umgeben von einem gewaltigen Platz, der die Fassade des Schlosses selbst mehr als wirkungsvoll zur Geltung brachte. Genau in der Mitte des Schlossprospektes wurde der Palast durchsichtig. Auf beiden Seiten befanden sich hohe Fenster, und so war das Tageslicht von der anderen Seite zu sehen. So viel Aufwand, ein ganzer Prunkpalast, nur um am Ende nichts anderes zu sehen als das reine Licht!
In einem links vorgelagerten Gebäude, eher selbst schon einem kleinen Barockschloss, befand sich das Institut für logische Grundlagenforschung der Universität. Wem der Präsident der Uni eine solche Nobeladresse verschafft, der muss schon ganz oben in seiner Gunst stehen, setzte der Zwickauer seine Betrachtung fort.
An diesem Ort war Robert Schönherrs Arbeitsplatz, zuerst als Assistent und danach im Rahmen eines gut dotierten Forschungsprojektes. Vielleicht konnte ihm hier ja jemand über den Verschollenen Auskunft geben. Jens musste es herausfinden, musste alles wissen. Er war ja der erste Zeuge. Seine Fotos vom Geschehen waren nicht manipuliert. Sie zeigten genau das, was er gesehen hatte – mit angehaltenem Atem, verstört und doch von dem Anblick so berührt, dass er sich erst eine halbe Stunde nach dem letzten Foto wieder nach oben vor das Kloster begeben, die Bilder an den Day ’n’ Nite gesendet und dann erst die Polizei alarmiert hatte. War das Recht oder Unrecht? Auf jeden Fall, wenn alles gut ging, wäre er mit diesen einzigartigen Fotodokumenten in Kürze um zwanzigtausend Euro reicher, und er könnte sich endlich zu Hause in Zwickau seinen Traum verwirklichen: ein Tausend-Quadratmeter- Studio in einer leerstehenden Fabrikhalle. Reichte ihm diese Aussicht nicht? Was suchte er dann noch hier an diesem Ort? Sensationelle Aufnahmen waren beim Herumschnüffeln an einem Institut der Universität sicher nicht zu erwarten, und noch mehr Geld würde mit Sicherheit nicht fließen – wenn Jack, dieser großspurige Heute-so- morgen-so-Typ nicht ohnehin nur leere Versprechungen gemacht hatte. Nein, es ging ihm um etwas anderes. Er hatte es gesehen, das wahre Antlitz des Menschen. Die Toten, »die Fünf«, wie sie in Presse und Internet nur noch genannt wurden, zeigten es. Um es bezeugen zu können, musste er verstehen, was dahinter stand. Nachdem die Fünf tot waren, konnte nur einer ihm dabei helfen, Robert Schönherr. Auch war dort unten im Keller des Klosters noch etwas anderes anwesend gewesen: nicht nur diese Seligkeit, dieser Friede auf ihren Gesichtern, sondern in den Raum war der Tod getreten, der plötzliche, unbarmherzige, allgewaltige Tod. Ja, er hatte ihn erschüttert, und Jens wartete auf den Moment, da er, diese Bilder vor Augen, in Tränen ausbrechen müsste. Aber der Tod, war er nicht selbst der Traurigste von allen? Kein lustvoller Sensenmann, dem die Ernte nicht schnell genug eingebracht werden konnte, eher der unterste Henkersknecht, den jeder Auftrag von denen da oben von neuem erschreckt. Ja, der Tod war traurig.
Читать дальше

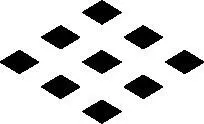 Worin Jens in einem noblen Forschungszentrum spioniert und mehr findet, als er gesucht hat
Worin Jens in einem noblen Forschungszentrum spioniert und mehr findet, als er gesucht hat