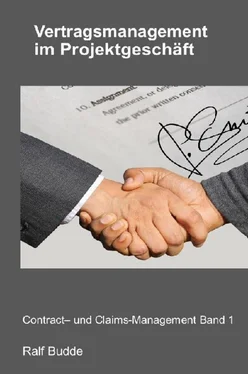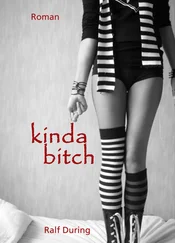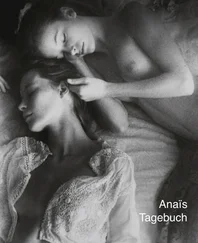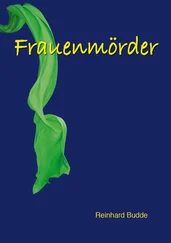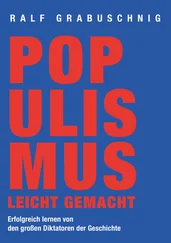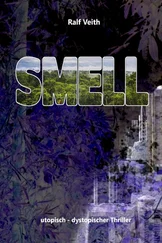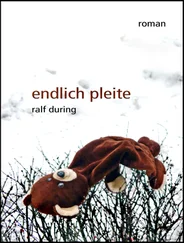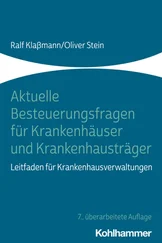Gerichtsverfahren
Gerichte in Deutschland
Ordentliche Gerichte
Die Ordentliche Gerichtsbarkeit in Deutschland ist 4-stufig aufgebaut. Das Grundgesetz nennt den Bundesgerichtshof (BGH) als obersten Gerichtshof des Bundes für das Gebiet der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Träger des Bundesgerichtshofs ist der Bund. Es ergibt sich damit folgendes Bild der ordentlichen Gerichtsbarkeit:
Bundesgerichtshof
Oberlandesgerichte
Landgerichte
Amtsgerichte
Da das Grundgesetz dem Bund nur das Recht für die Errichtung des Bundesgerichtshofs gibt, liegen die Oberlandesgerichte, die Landgerichte und die Amtsgerichte in der Trägerschaft der Bundes-Länder. Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle Strafsachen, alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilsachen) und alle Verfahren aus der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Hierzu zählen vor allem:
Grundbuchsachen
Registersachen
Vormundschaftssachen
Nachlass-Sachen
Personenstandssachen
Wohnungseigentumssachen
Die Strafsachen und die Zivilsachen gehören in erster Instanz vor ein Amtsgericht oder ein Landgericht, während die Verfahren aus der freiwilligen Gerichtsbarkeit in erster Instanz immer beim Amtsgericht beginnen.
Die Arbeitsgerichtsbarkeit
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist 3-stufig aufgebaut. Träger des Bundesarbeitsgerichts ist der Bund. Neben dem Bundesarbeitsgericht gibt es auch noch die Landesarbeitsgerichte (LAG) und die Arbeitsgerichte (ArbG). Die Landesarbeitsgerichte und die Arbeitsgerichte liegen in der Trägerschaft der Bundesländer. Es ergibt sich damit folgendes Bild der Arbeitsgerichtsbarkeit:
Bundesarbeitsgericht
Landesarbeitsgerichte
Arbeitsgerichte.
Die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit entscheiden im Wesentlichen bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien (Tarifvertragssachen) oder zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis (auch über dessen Bestehen) sowie aus unmittelbar damit zusammenhängenden Rechtsverhältnissen (Arbeitsverhältnissachen). Außerdem entscheiden die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit über Betriebsverfassungssachen und Mitbestimmungssachen. In erster Instanz entscheiden die Arbeitsgerichte, während die Landesarbeitsgerichte über das Rechtsmittel der Berufung entscheiden und das Bundesarbeitsgericht über das Rechtsmittel der Revision.
Die Sozialgerichtsbarkeit
Die Sozialgerichtsbarkeit ist 3-stufig aufgebaut. Träger des Bundessozialgerichts ist der Bund. Die weiteren Gerichte auf dem Gebiet der Sozialgerichtsbarkeit ergeben sich aus dem Sozialgerichtsgesetz (SGG). Danach gibt es neben dem Bundessozialgericht auch noch die Landessozialgerichte (LSG) und die Sozialgerichte (SG). Die Landessozialgerichte und die Sozialgerichte liegen in der Trägerschaft der Bundesländer. Es ergibt sich damit folgendes Bild der Sozialgerichtsbarkeit:
Bundessozialgericht
Landessozialgerichte
Sozialgerichte.
Die Sozialgerichtsbarkeit entscheidet über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten. Das sind Streitigkeiten, in denen sich die Parteien im Über- und Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen, wie z.B. im Verhältnis Behörde/Staat - Bürger.
Zu den Aufgaben der Sozialgerichtsbarkeit gehört im Wesentlichen die Entscheidung öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Arbeitsförderung und der Kriegsopferversorgung sowie des Kassenarztrechtes. In erster Instanz entscheiden die Sozialgerichte, während die Landessozialgerichte über das Rechtsmittel der Berufung entscheiden und das Bundessozialgericht über das Rechtsmittel der Revision.
Die Finanzgerichtsbarkeit
Die Finanzgerichtsbarkeit ist 2-stufig aufgebaut. Träger des Bundesfinanzhofs ist der Bund. Die weiteren Gerichte auf dem Gebiet der Finanzgerichtsbarkeit ergeben sich aus der Finanzgerichtsordnung (FGO). Die Finanzgerichte liegen in der Trägerschaft der Bundesländer. Es ergibt sich damit folgendes Bild der Finanzgerichtsbarkeit:
Bundesfinanzhof
Finanzgerichte.
Die Finanzgerichtsbarkeit entscheidet ebenfalls über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten. Sie ist insbesondere zuständig für Klagen gegen Finanz- und Zollbehörden in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über Steuern (Steuersachen) und Zölle (Zollsachen). In erster Instanz entscheiden die Finanzgerichte, während der Bundesfinanzhof über das Rechtsmittel der Revision entscheidet.
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist 3-stufig aufgebaut. Träger des Bundesverwaltungsgerichts ist der Bund. Die weiteren Gerichte auf dem Gebiet der Verwaltungsgerichtsbarkeit ergeben sich aus der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Danach gibt es neben dem Bundesverwaltungsgericht auch noch die Oberverwaltungsgerichte/ Verwaltungsgerichtshöfe (OVG(VGH) und die Verwaltungsgerichte (VG). Die Verwaltungsgerichte liegen in der Trägerschaft der Bundesländer. Es ergibt sich damit folgendes Bild der Verwaltungsgerichtsbarkeit:
Bundesverwaltungsgericht
Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe
Verwaltungsgerichte.
Auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit entscheidet über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten hat aber eine Auffangzuständigkeit. Demnach gehören vor die Verwaltungsgerichtsbarkeit alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten, die nicht der Sozialgerichtsbarkeit oder der Finanzgerichtsbarkeit zugewiesen sind. Hieraus ergibt sich ein sehr weites Aufgabenfeld für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Zu den wichtigsten Aufgaben der Verwaltungsgerichtsgerichtsbarkeit gehören
Bauordnungssachen- und Kommunalsteuersachen
Pass-, Ausländer- und Asylsachen
Sozialhilfe-, BaföG- und Wohngeldsachen
Polizei- und Ordnungsrechtssachen
Schul-, Hochschul- und Prüfungssachen
Gewerbe- und Gaststättensachen
Beamten- und Richtersachen
Wehr- und Zivildienstsachen.
In erster Instanz entscheiden die Verwaltungsgerichte, während die Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe über das Rechtsmittel der Berufung entscheiden und das Bundesverwaltungsgericht über das Rechtsmittel der Revision.
Jedem Rechtssuchenden steht es frei, sich durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl vor Behörden oder Gerichten vertreten zu lassen. Nach § 3 der Berufsordnung der Rechtsanwälte, der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAGO) ist der Rechtsanwalt der „berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten“. Beim Amtsgericht kann man auch ohne Anwalt prozessieren (außer bei bestimmten Familiensachen). Dort hilft bei der Formulierung der Klage - und auch bei Schreiben im Laufe des Verfahrens wie der Erwiderung auf die Klage - eine Rechtspflegerin oder ein Rechtspfleger der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts kostenlos.
In einigen Fällen, bei denen Erklärungen beurkundet werden müssen (z.B. Grundstücksverträge, Gesellschaftsverträge) vertritt auch der beurkundende Notar die Parteien vor den Gerichten, wenn sie ihn dazu ermächtigt haben. Damit wird gewährleistet, dass die notwendigen Anträge (z.B. für Eintragungen im Grundbuch) in der richtigen Form erfolgen und die Abwicklung komplizierter Rechtsgeschäfte in rechtskundiger Hand verbleibt. Darüber hinaus können die Parteien in großem Umfang aber Erklärungen auch vor den Gerichten selbst abgeben und dabei z.B. die Hilfe der Rechtsantragstelle in Anspruch nehmen. In einigen Fällen sieht das Gesetz aber vor, dass sich die Parteien von Rechtsanwälten vertreten lassen müssen, man spricht dann von „Anwaltszwang“ oder „Anwaltsprozess“. Wichtigste Bestimmung hierzu ist der § 78 der Zivilprozessordnung (ZPO). Er sieht vor, dass sich die Parteien bei den Landgerichten und allen höheren Instanzen (Oberlandesgerichten, Bundesgerichtshof) durch einen bei diesem Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen. Darüber hinaus sind auch vor den Amtsgerichten einige Familiensachen (z.B. Ehescheidungen, Auseinandersetzungen von Lebenspartnerschaften) vertretungspflichtig. Wer ohne rechtsanwaltliche Vertretung in diesen Verfahren tätig wird riskiert, dass seine Anträge wegen Unzulässigkeit abgewiesen werden und er Rechtsverluste erleidet.
Читать дальше