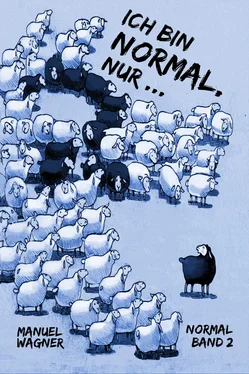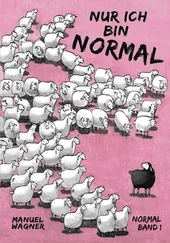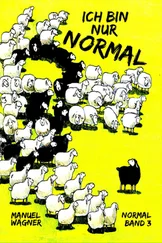Irgendwann werde ich müde, und lege mich einfach auf den Waldboden. Am Anfang hatte ich noch Probleme mit den vielen Unebenheiten. Mittlerweile bin ich daran gewöhnt. Ich stelle mir vor, dass mich die Katze weiter anstarrt, während ich schlafe. Das ist mir jedoch egal, sie kommt ja sowieso nicht näher.
Als ich wieder aufwache, spüre ich ein Stupsen. Ist es die Katze? Ich fühle einen leichten Lufthauch, so als würde etwas ganz schnell weglaufen, und als ich meinen Blick in die Richtung wende, wo ich das letzte mal die Katze gesehen habe, ist sie auch schon wieder genau an diesem Ort. Ich meine, ich habe sie sogar noch einige Schritte laufen sehen, bis sie wieder ihren gewohnten Abstand erreicht hatte. Ich bin traurig und wütend. Ich schnappe mir einen Stein und werfe ihn in die Richtung der Katze. Ich bin überrascht, wie weit ich werfen kann. Immerhin die halbe Strecke bis zur Katze habe ich geschafft. Die Katze ist natürlich nicht beeindruckt. Sie hat sich keinen Zentimeter bewegt und starrt weiterhin in meine Richtung.
»Komm doch her! Du warst doch gerade bei mir. Wieso kommst du nicht zu mir, wenn ich wach bin? Wieso starrst du mich immer so an?«
Haben sich gerade die Ohren bewegt? Werde ich verrückt? Ich rede mit einer Katze und erwarte, dass sie auf mich hört und mich versteht. Sollte ich nicht besser die Katze ignorieren und nach Zivilisation Ausschau halten? Meine eigenen Gedanken fühlen sich absurd an, denn eigentlich befinde ich mich in einer Situation, die ich sehr schön finde. Ich sag mal so: Zivilisation ohne Menschen wäre schön. Ich bin schon so lange hier, oder besser gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Ich habe es vor langer Zeit aufgegeben zu glauben, dass ich jemals wieder was anderes sehen werde außer diesem Wald und dieser Katze. Vielleicht laufe ich auch im Kreis. Ich weiß es nicht.
Ich werfe erneut einen Stein in Richtung Katze. Wow! Das war jetzt schon äußerst knapp. Die Katze rührt sich nicht. Noch ein Versuch. Ich laufe so schnell ich kann in Richtung Katze, und stoße dabei einen Kampfschrei aus. Ich weiß nicht, was ich will. Will ich sie töten, will ich, dass sie verschwindet, will ich mich mit ihr anfreunden, will ich mit ihr kämpfen? Ich weiß es nicht. Ich werde verrückt. Hab ich überhaupt schon was gegessen oder zumindest was getrunken? Ich erinnere mich nicht. Ich habe keinen Hunger und keinen Durst. Ich muss aber mal was gegessen haben. Immerhin bin ich hier schon ewig. Wie bin ich hier eigentlich her gekommen? Mein Versuch ist vergeblich. Es ist wie jedes Mal. Ich kann der Katze nicht näher kommen. Habe ich ein Stück geschafft, entfernt sie sich wieder, sodass sich der Abstand zwischen uns wieder angleicht. Ich sinke zu Boden und heule.
Warum mache ich das? Denke ich, dass die Katze Mitleid empfinden wird, und doch näher kommt? Ich blicke mit meinem tränenverschmierten Gesicht hoch. Doch nichts. Keine Regung. Es ist eben nur ein Tier. Was erwarte ich eigentlich? Dieses Spiel geht einfach schon zu lange. Seit ewigen Zeiten bin ich dieser Situation ausgeliefert, nichts ändert sich. Ich will nicht mehr. Die Wut richtet sich gegen die Katze. Ich kann ja sonst auf niemanden meine Wut projizieren. Wäre die Katze nicht hier, müsste ich mich selbst verletzen. Ich schnappe mir einen großen Stein, und schleudere ihn wiederholt in Richtung Katze, wohl wissend, dass ich niemals weit genug werfen werde können. Selbst wenn ich die Weite erreichen würde, könnte die Katze, aufgrund der langen Flugdauer, diesem Stein ohne Probleme ausweichen. »WAAAAAAAAAAAAAHHHH! Ich hasse dich! Stirb doch endlich! Stirb!« Oh nein. Was habe ich getan. Der Stein wird die Katze treffen. Mein Blick folgt der Flugbahn. Ich versuche den Stein mit meinen Gedanken aufzuhalten.
»Geh weg Katze! Geh weg! Der Stein! Der Stein!!!«
Doch die Katze bewegt sich nicht und es kommt, wie es kommen muss. Der Stein trifft die Katze am Kopf, und sie fällt einfach um wie ein ausgestopftes Tier. Oh nein. Ohne weitere Gedanken laufe ich zu dem unschuldigen, wahrscheinlich toten Tier. Der Schock mischt sich mit der Neugier, die Katze näher betrachten zu können. Als ich nah genug dran bin, um das Tier in Augenschein zu nehmen, springt es auf einmal über meinen Kopf. Kurz darauf spüre ich einen heftigen Stoß. Etwas Großes und Schweres drückt mich auf den Waldboden. Plötzlich spüre ich etwas an meinem Arm. Es sind Zähne, die mich mit einem heftigen Ruck zum Umdrehen zwingen. Ich bin starr vor Angst. Ein riesiger prähistorischer Wolf atmet mir ins Gesicht und fletscht dabei seine Zähne.
»Sei ehrlich, so willst du mich doch haben.«
Die Stimme klingt finster. So stellt man sich die Stimme und das Aussehen eines bösen Wolfes vor, der aus einem definitiv nicht kindgerechten Märchenbuch entsprungen ist. Trotzdem ist mir ihr Klang vertraut.
»Sag schon! So willst du mich doch haben.«
Ein heftiger Biss folgt in meinem Arm. Ich spüre keinen Schmerz, sondern Lust.
»Sag, dass du mich so willst! Du willst mich nicht anders.«
Ein erneuter Biss diesmal in den Oberkörper. Ich blute, aber ich empfinde noch mehr Lust.
»Beiße mich! Ich will, dass du mich beißt.«
Die Wunden tun plötzlich weh. Der Schmerz raubt mir den Atem. Die Lust ist weg. Ich verliere das Bewusstsein... oder wache ich gerade auf?
Klare Gedanken dringen in meinen Kopf. Gerade noch war ich mir sicher, dass ich sterbe. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Ich spüre wieder etwas, aber mein Körper gehorcht mir nicht. Ich versuche, meine Augen zu öffnen. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis mir das gelingt. Meine Ohren sind beschlagen.
»Krankenschwester! Krankenschwester! Doktor! Doktor!...« höre ich dumpf, verfremdet und undeutlich, so als wäre die Stimme weit weg, aber ich bin mir nun sicher, dass ich in einem Krankenhaus bin. Wem gehört die Stimme neben mir? ... oh nein… Alles was ich fühle, ist Schmerz. Der Versuch die Augen zu öffnen, ist zu anstrengend. Die Anstrengung gibt mir den Rest. Ich schaffe es nicht.
Als ich erneut das Bewusstsein erlange, habe ich wieder ein Zeitgefühl. Ich muss nach dem vorherigen kurzen Aufwachen ein paar Stunden geschlafen haben. Zuerst ist es ein schmaler heller Fleck verschwommenen Lichts, dann entsteht langsam ein Bild. Keine Wurzeln, kein Moos, keine Bäume, keine Katze: So trostlos wie alles hier erscheint, könnte es sich dieses Mal um die Realität handeln. Überall ist gleißendes Weiß. Nachdem sich meine Augen an das Neonlicht gewöhnt haben, sehe ich zur Abwechslung ein paar blinkende rote, grüne und gelbe Lichtpunkte auf kantigen Geräten. Es riecht scharf nach Desinfektionsmitteln. Ich sehe niemanden, und bin zum ersten mal traurig deswegen. Ich bin schockiert über die vielen Schläuche an und in meinem Körper und über die Geräte neben mir. Mein Körper ist schlapp und verkrampft zugleich. Es fühlt sich an, als würde jemand an meiner Bauchdecke ziehen, aber ich bin noch betäubt genug, deshalb ist es wohl kein richtiger Schmerz. Ich muss meine Gedanken sortieren, vielleicht kommt gleich jemand, und fragt mich was. Wo sind eigentlich die Schmerzen hin, die mich in die erneute Bewusstlosigkeit getrieben haben, die mir der Wolf zugefügt hat? Nein, nein, nein! Das war nicht echt. Die Schmerzen hatten eine andere Ursache. Nur welche?
Damit ich mich bewegen kann, führe ich einen inneren Dialog mit meinen Gliedmaßen. Sie antworten nicht. Dabei würde ich jetzt gern aufspringen und tanzen, weil ich lebe und mich viel besser fühle, als beim ersten Erwachen. Mein Gesicht wirkt weniger taub als der Rest. Es ist nur so betäubt, wie nach einer Zahnarztspritze. Mein »Hallo ist da jemand?«, klingt aber eher wie ein Tiergeräusch von einem Haustier, dass zu recht kurz vor der Einschläferung steht. Plötzlich öffnet sich die Tür. Zu wem gehören die Umrisse? Sind das meine Eltern, andere Verwandte, Krankenpfleger, Ärztinnen? Was ich erkenne, als es näher kommt, verwirrt mich, erregt mich. Ich wusste nicht, dass das erlaubt ist. »Du bist doch kein …?« Tränen schießen in meine Augenwinkel als ich Hündchen erkenne. Es sind keine Tränen der Angst. Es sind auch keine Tränen der Trauer. Es ist etwas anderes. Ich erinnere mich wieder. Es muss der Geruch nach Vanille sein. Der Geruch, den ich als Letztes in meiner Nase hatte. Es war Hündchen. Hündchen muss mich gerettet haben. Hündchen guckt glücklich, wie ein Welpe, der gerade die Milchzitzen seiner Mutter gefunden hat. »Ich mach jetzt etwas, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, und ich erkenne an deinen Augen, dass du es auch möchtest.« Hündchen formt Kusslippen, die dann auf meinen halbtauben mit Speichel benetzten Mund treffen. Mein Speichel klebt an Hündchens Unterlippe. Hündchens Pfote wandert durch das für einen Hund ungewöhnlich unbehaarte Gesicht. Unseren ersten Kuss haben wir uns wohl beide anders vorgestellt.
Читать дальше