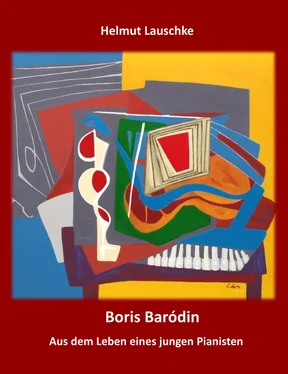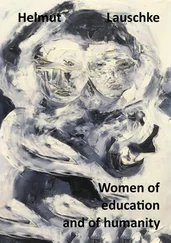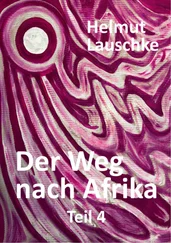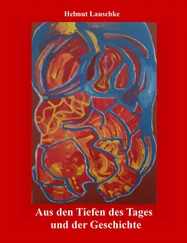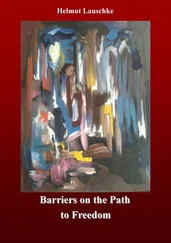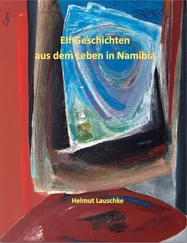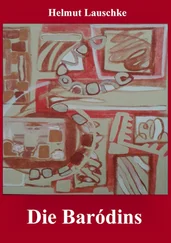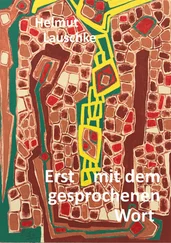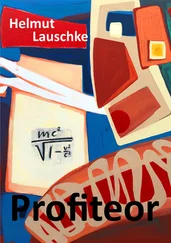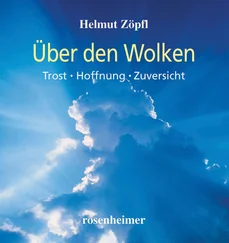Boris erinnerte sich an Großvaters Sätze mit dem Abend- und dem Morgenstern: “Der dorfbrunnersche Namensstern sei im Untergehen begriffen und wird als Abendstern in die Tiefen des Universums versinken. Dagegen wird der Wunderenkel wie ein heller Morgenstern aufgehen, wenn auch nicht als ein Dorfbrunner, sondern als Boris Baródin. Er wird am Himmel der Musik leuchten und noch viel Licht in die Menschheit strahlen.” Die Gedichtsstrophen stimmten schwermütig. Warum diese Schwermut mit dem Gleichnis der sterblichen Augen, wenn Ilja Igorowitsch von der großen Freude auf ein Wiedersehen schreibt? Ist er denn krank, dass er an den Tod, ans Sterben denkt? Boris konnte sich das Gedicht im Zusammenhang mit dem sonst positiven, lebensbejahenden Briefinhalt nicht erklären. Ist Vater denn unglücklich, dass er mit “was Ströme beweinen” den Tränenstrom meint, in dem sich die anfänglichen Gefühle für die junge Lettin, die er in Leningrad kennengelernt hat, mit der er zusammenlebt, verknittert und verhärtet zurückkehren? Was bedeutet die Erhebung der zwei Sonnen und zwei Schlünde im gewaltigen Strahlenschein anders, als dass sich dazwischen der Abgrund öffnet, der sich, wie es im Gedicht heißt, in den zwei sterblichen Augen so klar wie in Diamanten spiegelt. Sind Komplikationen nach der Notoperation aufgetreten, der sich Ilja Igorowitsch wegen des blutenden Magengeschwürs unterziehen musste? Warum schreibt Vater nicht, wie es ihm geht? Warum hüllt er sich in Schweigen, was seine Gegenwart, seine Gesundheit und seine unmittelbare Umgebung betrifft?
Für Boris hatte der Brief einen schwermütigen Abschluss, der ihm nicht nur zu denken gab, sondern ihm Sorgen machte, Sorgen um die Gesundheit des Ilja Igorowitsch und Sorgen um das Leben, das er lebt. Boris faltete mit all den geweckten Erinnerungen an Ilja Igorowitsch und Eckhard Hieronymus Dorfbrunner den Brief zusammen und schob ihn nachdenklich in den Umschlag und legte den Umschlag auf den Stapel der offen liegenden Partituren neben das Schreiben des Konzert-Agenten Berthold Graf und dem noch ungelesenen Brief eines unbekannten Absenders. Er ging in die Küche mit dem Gewicht des Briefes. Die Gedichtsstrophen der Marina Zwetajewa machten das Schwergewicht des Briefes aus. Er füllte den Wasserkessel, setzte ihn auf den Herd, stand vor dem Fenster mit dem “Blick nach Moskau”, nahm das Tanzen des Kesseldeckels nicht gleich wahr und goss das kochende Wasser in das Teesieb mit dem chinesischen Kräutertee. Er rührte den Teelöffel Zucker ein, ging zurück ins Arbeitszimmer, stellte die volle Teetasse auf den kleinen Klubtisch, setzte sich an den Flügel und spielte den ersten Sonatensatz aus Beethoven’s Pathétique. Zur Schwermut, die ihm der Brief des Ilja Igorowitsch vermittelt hatte, kam nun die beethovensche dazu, dass Boris nach den ersten Takten die Tränen vor den Augen standen, die er tropfen ließ, und den Satz mit Tränen zu Ende spielte. Er ging zur Klubecke, setzte sich in den schmalen Sessel, trank mit bedächtigen Schlucken den Tee, sah aus dem Fenster, war mit seinen Gedanken woanders, aber nicht in der Knesebeckstraße 17, dass er das Klingeln des Telefons nicht gleich wahrnahm. Bei welchem Klingelzeichen er den Hörer abgenommen hatte, wusste er nicht. Jedenfalls ertönte das Leerzeichen, als er die Hörmuschel ans Ohr drückte. Er ging an den Klubtisch zurück, trank vom Tee und nahm den Fensterblick “Richtung Moskau” wieder auf. Das Telefon klingelte wieder. Er nahm beim dritten oder vierten Klingelzeichen den Hörer ab und meldete sich mit “Hallo”. “Ach du bist’s, Claude. Ist es schon elf? O, es ist gleich zwölf. Ich war hier. Als ich den Hörer abgenommen habe, hat sich keiner gemeldet. Am besten ist es, wenn ihr um zwei zu mir kommt. Danke, mir geht es besser. Bis dann.” Boris legte den Hörer auf und fragte sich in der zurückkehrenden Nüchternheit des nachdenkenden Bewusstseins, ob es sinnvoll sei, weiter “nach Moskau” zu blicken. Der Verstand erklärte ihm, dass durch den verlängerten Ostblick, auch wenn er von tiefen Gefühlen begleitet wird, sich am Zustand von Ilja Igorowitsch nichts ändert. Zudem drängte die Zeit mit den bevorstehenden Konzerten, für die noch viel zu tun war.
Er setzte sich an den Flügel und spielte Brahms. Zunächst den zweiten Satz, dann den ersten, beide aus der Meditation heraus, was das Leben ist und was der Mensch, was mit Worten nicht zu sagen ist. Beim Eingangsmotiv des ersten Satzes mit den steigenden Viertelnoten B-C-D, der herabgleitenden Triole Es-D-C, dann dem D als Viertelnote und dem angebundenen Fermaten-F als Dreiviertelnote, das aus dem Orchester in den ersten beiden Takten erklingt, spürte Boris den Ruf des Vaters aus der Tiefe, sah ihn am Lauf der Wolga stehen, nachdenklich schweigend mit der Knittrigkeit der Gefühle und der Schwermütigkeit, die ihm das Leben auflud. Aus dieser Meditation heraus und aus dem Gespür, den stummen Schrei von Ilja Igorowitsch wahrzunehmen, setzte Boris den stakkierten Triolenlauf über den “Wolgaklang” des Orchesters, über das schwere, schweigende Wasser des breiten Stromes, der unter dem weiten Spiegelfächer der späten Nachmittagssonne das Gewesene der frohen Heiterkeit und die vergängliche (Sekunden-)Kürze des einst erfüllten Glücks beweint. Das Stakkato war so kristallklar und kräftig, als würfen Kinder kleine, runde Flachsteine über das Wasser, um das Schweigen des Stromes zu brechen, seinem dahinfließenden, nie anders gekannten Lauf der unergründlichen Schwermut die Clownsmütze aufzusetzen, ihm den abgründigen Tiefgang zu nehmen, Freude und Ansporn beim Anblick seines Fließens zu empfinden, indem die Steine weit über das stille Wasser sprangen. Es war der Wettstreit unter Kindern, deren Gesichter den springenden Steinen hinterherlachten und staunten, wenn sie weit genug gesprungen waren. Doch Kinder, die in den Dörfern geboren wurden und aufwuchsen, die zu beiden Seiten des Stromes lagen und jahraus-jahrein seinen Lauf mit der Ruhe der natürlichsten Ergebenheit begleiteten, wussten, dass sie und ihre kleinen, runden Flachsteine den majestätischen Strom nicht und niemals überspringen können. Die Wolga war ihre große unsterbliche Mutter im Denken und Fühlen und in so vielen Geschichten und Erzählungen.
Boris, dem die Erinnerungen der springenden Steine über das Wasser bei den Stakkato-Triolenläufen am Anfang des ersten Satzes im zweiten Klavierkonzert von Brahms mitspielten, hatte Freude am Spiel, Freude an den springenden Läufen, denn er wollte die Schwermut um Ilja Igorowitsch nicht noch schwerer werden lassen, sondern sie auf konzertantem Wege lockern, leichter machen, damit noch Platz zum Atmen und Raum zum Leben blieb. Doch setzte er der Schwermut nicht die Clownsmütze auf, auch wenn er sie oft vermisste. Stattdessen legte er dem schweren Wellengang die Dvořák’sche oder Bartók’sche Humoreske in Brahms’scher hanseatisch geordneter Weise auf. Hinzu kam der Genesungsprozess vom grippalen Infekt mit dem lästigen Husten und der eitrigen Tonsillitis nach Einnahme der Penicillintabletten und Hustentropfen, der Fortschritte machte. Das gab den Auftrieb, den er brauchte. Auch schwitzte er nicht mehr so stark.
So gewann Boris beim Spiel die virtuose Leichtigkeit und künstlerische Aussage zurück, die das Besondere, das persönlich Unverwechselbare im Vortrag des großartigen Werkes ausmacht. Das Spielen auf dem Flügel ging ihm von den Fingern, während er innerlich über den Menschen und sein Leben meditierte. Dabei kehrten Träume wieder, die zurück in die Kindheit bis in die Geburtsstadt Bautzen in der Oberlausitz reichten, wo er auf dem Schoße des Vaters vor dem Försterflügel saß und Ilja Igorowitsch ihm das Drücken der Tasten vorführte und die ersten kleinen Fingersätze für kleine Kinderhände in liebevollster Geduld mit ihm übte. Im Glück dieser Augenblicke und der kindlichen Neugier hatte er natürlich nicht begriffen, dass der Vater ein russischer General und der erste Stadtkommandant nach einem für die Deutschen verlorenen Weltkrieg war. Er liebte seinen Vater grenzenlos, konnte ihm auf dem Kopf rumtanzen und ihm die Finger verdrehen, ohne dass ein ernstes Wort gefallen oder ein Verbot ergangen wäre. Dass ein Kind mit einem Vater, der General und Kommandant der Stadt war, so etwas machen konnte, diese Großartigkeit kam ihm erst viel später in den Sinn.
Читать дальше