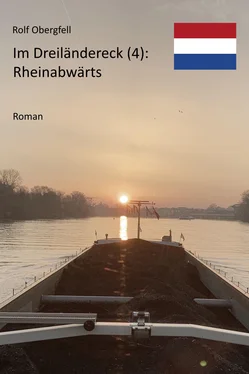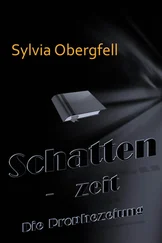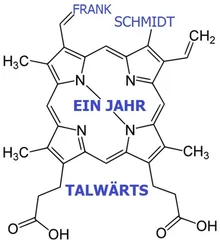"Das Verladen und Löschen solcher Container ist demnach ziemlich mühsam?"
"Würde ich nicht sagen. Luuk muss nur einen Stecker einstecken, aber er ist ja sowieso dabei, wenn die Container bewegt werden."
"Macht das nur er?"
"Meistens jedenfalls. Mir macht das Laden keinen Spaß, ich fahre lieber. Luuk geht da auf mich ein."
"Und warum habt ihr nur so wenig Container geladen? Die reichen ja nicht einmal bis zur Bordkante."
"Wir sind ein Mehrzweckfrachter, ein multi purpose carrier . Da wir keine Stabilitätsberechnung haben, sind uns nur zwei Lagen erlaubt."
"Heißt das, ihr transportiert vor allem andere Güter – Kohle, Getreide, Schrott?"
"Genau, wir fahren, was gerade kommt. Für dazwischen gibt es Reinigungsvorschriften, das ist ziemlich streng geregelt."
"Irgendwie bin ich beeindruckt. Das ist alles viel komplizierter als es aussieht."
"So geht es den meisten Leuten. Viele meinen, wir würden mal eben ein paar Blechkisten hin und her transportieren."
Strickmann schwieg. Diese Marit beherrschte nicht nur alles, was mit ihrem Schiff zusammenhing, sie wusste auch genau, was den Leuten durch den Kopf ging, die an Schleusen oder Brücken so freundlich herunterwinkten – oder an Bord kamen, um ein Stück mitzufahren.
An Steuerbord tauchte hinter dem Wald der Isteiner Klotz auf, ein gewaltiger Brocken aus Kalkstein. Auf Grund von eingeschlossenen Ammoniten konnten die verschiedenen Schichten einzelnen erdgeschichtlichen Perioden zugeordnet werden. Grob gerechnet ist er 160 Millionen Jahre alt und gehört in die Periode des Jura, die man Oxfordium nennt.
Das Gebiet des heutigen Süddeutschland war damals vom Jurameer bedeckt, dessen Grund etwa 1.000 Meter höher lag als heute der Feldberg, die höchste Erhebung des Schwarzwaldes. Dieses Meer trocknete aus und es entwickelte sich eine Landschaft, die der heutigen Tundra ähnlich war. Während der Grabenbrüche und der Erosion, die im Laufe der letzten 30 Millionen Jahre stattfanden, wurde das Kalkstück, das heute Isteiner Klotz heißt, unterspült. Es rutschte als Ganzes ab und versperrte dem Wasser den Weg nach Norden, so dass der Rhein durch das Rhonetal ins Mittelmeer abfließen musste. Das war vor 3,5 Millionen Jahren und daran kann sich niemand mehr so richtig erinnern. Trotzdem gab es im Gebiet des heutigen Deutschland auch damals einen Rhein. Dieser Ur-Rhein entsprang südlich des Kaiserstuhls und mündete dort ins Meer, wo heute Köln liegt. Das Land von dort bis zur Nordsee ist seitdem angeschwemmt worden. Das ist eine Menge Material, aber der Fluss hat auch lange Zeit gehabt dafür. Von der Stelle des heutigen Bodensees mit einer Tiefe bis 250 Meter fließt der Rhein seit 800.000 Jahren nach Westen, vorher mündete er nordöstlich in die Donau. An den Bodensee, die Grenze zwischen Alpenrhein und Hochrhein, hat damals allerdings noch niemand gedacht, der ist erst 17.000 Jahre alt.
Die Gegend um den Isteiner Klotz ist aber nicht nur für uns heute interessant, sie war es auch schon für die Menschen der Mittleren Steinzeit, deren geologische Kenntnisse noch nicht ganz so differenziert waren. Für sie standen Aspekte der unmittelbaren Nützlichkeit im Vordergrund: Sie siedelten an Flüssen und bevorzugten dabei aus einem Schutzbedürfnis heraus erhöhte Punkte in der Landschaft. Dadurch hatten sie sowohl einen fantastischen Ausblick und die damit verbundene Vorwarnzeit als auch Geländevorteile, falls es tatsächlich zu einem Angriff kam. Außerdem waren sie so bei Überschwemmungen vor dem Hochwasser sicher. Der Basler und der Breisacher Münsterhügel waren solche Orte oder eben der Isteiner Klotz. 1939 wurde in der Nähe beim Bau der Eisenbahnlinie eine Höhle entdeckt. Archäologische Grabungen ergaben, dass die Menschen der Steinzeit dort systematisch Jaspis abgebaut hatten – der Stoff, aus dem ihre Werkzeuge und ihre Träume waren. Zum Glück fanden sie heraus, dass der Kalk, in den die faustgroßen Knollen eingebettet waren, durch Feuer und Wasser aufgelockert werden kann. Sie entzündeten also vor den Kalkwänden Holzfeuer, löschten mit Wasser ab und brauchten nur noch den weichen Kalk zu entfernen und die Jaspisknollen einzusammeln. Damit machten sie sowohl sich selbst glücklich als auch die heutigen Archäologen, denen es mit den übrig gebliebenen Holzkohleresten und der C 14-Methode gelang, diesen Jaspisbergbau zeitlich zu bestimmen: Er fand um 4200 v. Chr. statt. Die Menschen am Rhein verfügten damit über den klassischen Rohstoff ihrer Epoche, aus dem sie Spitzen für Pfeile, Lanzen und Speere herstellen konnten, dazu Schaber, Kratzer und Messer. Die Schneiden dieser Werkzeuge waren so scharf wie unsere heutigen Rasierklingen und machten aus ihren Distanzwaffen tödliche Geschosse, mit denen sie selbst Großwild und Raubtiere der damaligen Zeit erlegen konnten: wollhaarige Nashörner, Mammute, Steppenwisente und Höhlenbären.
Im kleinen Museum des Nachbarstädtchens sind Baggerfahrer, Landschaftspfleger oder Tiefbauarbeiter willkommene Gäste. Und sie kommen gerne. In Milchkannen, Obstschalen oder eingewickelt in Zeitungspapier bringen sie, was sie so gefunden haben bei ihrer Arbeit: Stücke steinerner Beilklingen oder Pfeilspitzen, Tonscherben von irdenen Krügen, römische Ziegel oder Fibeln aus Bronze und Eisen. Das alles ist wissenschaftlich belanglos, denn es ist schon tausendfach vorhanden, aber es bestätigt immer wieder aufs Neue: Alle waren sie da in der Rheinebene – alle.
Unmittelbar neben dem Kanal, jenseits einer künstlichen Insel zum Wald hin, fließt der alte Rhein, umgeben von einer variantenreichen Vegetation. Dichtes Buschwerk wechselt ab mit Teppichen von gelben Sumpfdotterblumen, im flachen Wasser liegen große Steine, an denen sich die Strömung bricht. Die Biologen unterscheiden in diesem Wald acht verschiedene Stockwerke. Wo es abgestorbenes Gehölz gibt, kann man Spechte hämmern hören und manchmal ruft ein Kuckuck. An einer Stelle fließt der Fluss durch ein Gewirr von Felsen, hat sie unterhöhlt oder Gräben hineingefressen, hat den Kalk ausgewaschen und Löcher gebildet wie in einem Schweizer Käse.
Diese Schwellen sind erst um 1904 aufgetaucht, weil der Wasserspiegel als Folge der Rheinbegradigung durch Tulla allmählich gefallen ist. Im Dorf Istein gibt es einen Felsen, an dem die erodierende Kraft des Wassers deutlich zu sehen ist – er liegt acht Meter höher als der heutige Wasserstand des Flusses. Im Bericht über die erste Fahrt eines Schleppzuges von Straßburg nach Basel werden diese Schwellen in der Literatur zum ersten Mal erwähnt 11. Solche Schleppzüge sind heute nur noch flussaufwärts der Mittleren Brücke in Basel zu sehen.
Nur die geschicktesten Paddler schaffen es durch diese Stromschnelle, wo das Wasser aus weißem Schaum zu bestehen scheint, in Wirklichkeit aber mit den Booten spielt wie mit abgefallenen Blättern im Herbst. Diejenigen, die um ihre Grenzen wissen, steigen aus, tragen ihre Boote um die Felsen herum und setzen sie flussabwärts wieder ein. Das Gelände ist günstig dafür, das Ufer flach, denn der Fluss hat Sand angeschwemmt.
Im Sommer findet schon frühmorgens eine regelrechte Invasion durch Großfamilien statt. Sie schleppen alles ans Wasser, was sie brauchen für einen erholsamen Tag: Getränkekisten, Kühlboxen, Gummiboote und Sonnenschirme, obwohl es mächtige Baumkronen gibt, die Schatten spenden. Manche bringen Holzkohle mit, andere ganze Campingausrüstungen. Hier kann man türkische Paschas sehen und italienische Matronen, die gemeinsam mit Einheimischen versuchen, ein Feuer in Gang zu setzen und überhaupt nicht verstehen können, warum das so schwierig ist. Ihre Kinder haben keinerlei Verständigungsschwierigkeiten, bilden Gruppen und können stundenlang ungestört spielen. Sie bauen Staudämme oder haben alte Vorhänge dabei, mit denen sie Jungfische fangen, die nicht länger sind als ein Fingernagel. Die älteren bauen Wasserräder oder sogar eigene Angelruten. Mit schier endloser Geduld biegen und schleifen sie Draht zu Haken oder entwirren ganze Knäuel von Plastikschnüren, die sie auf dem Rheinuferweg entlang des Flusses gefunden haben. Sie empfinden es als Zuwendung, wenn ein Erwachsener aus ihrer Familie sie zurückruft zum Ufer oder ihnen aufträgt, sich eine Weile in die Sonne zu setzen und aufzuwärmen. Sie fühlen sich behütet. Die richtig großen sammeln Brennholz für ein Lagerfeuer und um die Mittagszeit ist die Luft geschwängert von Bratenduft. Die kleinen allerdings wollen nichts wissen von halben Hähnchen oder Lammkoteletts. Sie haben Interessanteres zu tun, entdecken andauernd eine neue Welt und erscheinen erst am Feuer, wenn sie richtig Hunger haben. Aber kaum haben sie ein paar Bissen gegessen, verschwinden sie wieder Richtung Wasser.
Читать дальше