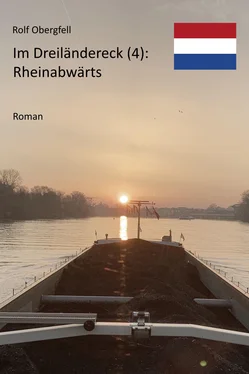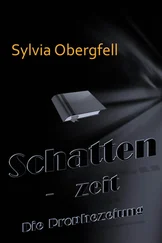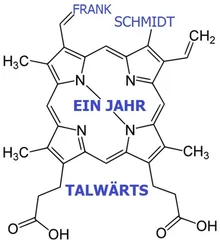Zurück im Steuerhaus, fragte Strickmann ohne jegliche Einleitung:
"Warum ist denn das Ablegemanöver so ritualisiert: Mach los! – Bug ist frei, Heck ist frei ? Das ist doch keine Sache, ein Tau von einem Poller zu nehmen."
Luuk bekam einen herablassenden Gesichtsausdruck, Marit erklärte:
"So denken alle Landratten und bis zu einem gewissen Punkt haben sie ja auch recht. Nichts ist eine große Sache auf einem Binnenschiff – solange alles funktioniert, wie es soll. Die Kunst ist, alles zu können und zu erkennen, wann was notwendig ist."
Diesen Standpunkt kannte Strickmann nur von absoluten Könnern. Solche Leute haben es nicht nötig, überall Gefahren zu sehen und dadurch ihre Fähigkeiten größer erscheinen zu lassen. Sie lösen ihre Aufgaben, wie sie auftauchen, machen darum kein großes Getue. Es konnte eine interessante Fahrt werden.
Marit war aber noch nicht zu Ende:
"Was meinst du, was hier los ist, wenn wir zum Beispiel durch starken Seitenwind abgetrieben werden? Oder wenn sich irgendwo im Fluss eine neue Sandbank gebildet hat und wir auf Grund laufen? Die Kosten und der Verdienstausfall, die damit verbunden sind, können dir finanziell das Genick brechen. Hier muss alles optimal laufen. Als ich noch Matrosin war, habe ich einmal eine richtige Katastrophe erlebt: Während eines Ablegemanövers unterhielt sich ein Kollege am Poller mit einer Frau, die sich gerade von ihm verabschiedete. Als er auf das Kommando des Schiffsführers nicht reagierte, kam die Frage, ob das Heck frei sei. Der Matrose nickte und der Schiffsführer gab Gas. Hinterher stellte sich heraus, dass das Nicken keine Antwort auf die Frage des Schiffsführers sein sollte, sondern auf eine Frage dieser Frau. Bei einem richtig einbetonierten Poller ist in so einer Situation das Drahtseil das schwächste Glied: Bei mehr als 16 Tonnen Belastung reißt es. Die beiden Teile peitschen mit einer solchen Gewalt durch die Luft, dass alles niedergemäht wird, was ihnen im Weg steht. In diesem Fall stand der Kollege im Weg und es traf ihn am Bauch. Als die Sanitäter endlich da waren, haben sie als Erstes die herausgequollenen Därme eingesammelt. Nach einer Stunde war er tot. Wie du ja festgestellt hast, wäre es keine große Sache gewesen, das wird tausendmal gemacht jeden Tag ..."
Marit wurde von ihren Erinnerungen übermannt, hatte plötzlich eine belegte Stimme. Luuk suchte in einer Schublade nach einer Packung Papiertaschentücher und reichte sie wortlos hinüber. Dazu legte er ihr eine Hand auf eine Schulter.
"Danke, du bist ein Schatz."
Als er nach einer Weile immer noch so dastand, meinte sie:
"Es ist schon gut. Du kannst ruhig schlafen gehen."
Luuk leerte seine Tasse mit dem Wundertee aus der Wüste und machte sich auf den Weg in sein Bett. Strickmann folgte ihm mit den Augen und war beruhigt, als er sah, dass selbst der Schiffsführer die Treppe zum Deck rückwärts hinunterging – sie war ihm extrem steil vorgekommen. Er würde es genauso machen.
"Und warum verwendet ihr nicht Leggo! als Kommando?"
"Das ist seit etwa 20 Jahren groß in Mode, man hört es überall. Wegen der großen Personalprobleme hat man in Holland Mitte der 90er Jahre angefangen, Leute aus Tschechien einzustellen. Die sind gut ausgebildet und haben eine Menge Erfahrung durch ihre Arbeit auf der Elbe. Angeblich haben die das Kommando mitgebracht und seitdem gilt es als schick. Wir hatten einmal einen Matrosen aus Tschechien, den habe ich danach gefragt. Und siehe da: Im Tschechischen gibt es das Wort gar nicht. Ein alter Lotse aus Duisburg, mit dem ich auch darüber gesprochen habe, hat nur nachdenklich den Kopf geschüttelt: Das Kommando gab es schon zehn Jahre, bevor die ersten Tschechen in Holland ankamen. Wir auf der Flamingo verwenden meistens Mach los! und jeder weiß, wie er darauf antworten muss."
Nach wenigen Kilometern, wenn der Kanal den Reiz des Neuen verloren hat, kommt Langeweile auf. Die Landschaft wird eintönig und zerschnitten von den schnurgeraden Begrenzungslinien des künstlich angelegten Flussbettes. Die kahlen grauen Betonplatten, mit denen es eingefasst ist, wirken zunehmend öde und tot, signalisieren die Eindimensionalität dieser Wasserstraße. Es ging den Erbauern um den Profit durch einen rationellen Transport, um nichts anderes. Dafür haben sie die Landschaft zugemauert und den Tieren ihren natürlichen Lebensraum genommen. Da ist kein Buschwerk mehr, in dem Vögel ihre Nester bauen oder Mäuse Schutz vor Räuber finden könnten, nirgendwo Schilf oder ins Wasser hängende Pflanzen, die den Fischen Unterstände böten. Kein Wunder, jagen hier keine Graureiher, sind nirgendwo eine Ente oder auch nur ein einziger Schwan zu sehen.
Selbst das Wasser erscheint künstlich: keine Wirbel, keine Wellen, nichts, was seinen Sauerstoffgehalt erhöhen würde. Es fließt träge, mühsam, als ob es nichts zu tun hätte mit der künstlich angelegten Landschaft, die es durchquert. Das ist kein Fluss mehr, das ist nur Wasser in einer betonierten Bahn. Es fällt schwer sich vorzustellen, dass hier unter dem Pflaster ein Strand liegen soll, dass in diesem Wasser vielleicht sogar Fische schwimmen. Da verwundert es nicht, dass eine alte Frau auf den Treppen sitzt und sich die letzten Strahlen der untergehenden Sonne ins Gesicht scheinen lässt – mutterseelenallein.
Das Gegenstück dazu kannte Strickmann aus dem Kunstmuseum in Basel. Es ist ein Gemälde von Peter Birmann, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Verlauf des Rheins gemalt hat – das Wasser ist übersät mit so vielen kleinen Inseln, mit so viel überquellendem Grün, dass eine Fahrrinne kaum zu erkennen ist. Und überall wuchernder Wald, Sandbänke und Ufer mit Pflanzenbewuchs – Natur pur.
Da die Pappelreihen rechts und links ihn nicht mehr interessierten, schaute er sich die Ladung genauer an. Wie im Hafen auch hier die genormten Metallkisten, die überall zu sehen sind, wo Waren transportiert werden: Vom Bug bis zum Heck stapeln sich im Laderaum zwei Lagen 40-Fuß-Container in allen Farben. Für den Transport auf der Straße wird für jeden einzelnen ein eigener LKW benötigt. Trotzdem – seit Strickmann sie beim Laden hatte durch die Luft schweben sehen, kamen sie ihm vor wie aneinandergereihte Streichholzschachteln, mit einer Containerbrücke einzeln aufgestapelt, im Ladeplan registriert und jederzeit auffindbar. Manche waren so neu, dass ihre Lackierung in der Sonne glänzte, andere mit stumpfer Oberfläche und großen Rostflecken.
An fast allen waren Drähte zu sehen, wie wenn es notwendig gewesen wäre, die Ladung gegen Verrutschen zu sichern. Aber bei einem Gewicht von 27 Tonnen ist das durch einen dünnen Draht natürlich nicht möglich.
"Was sind denn das für Drähte, die da überall zu sehen sind?"
"Das sind keine Drähte, das sind Stromkabel. Unsere Ladung besteht aus Medikamenten und Schokolade und muss deswegen gekühlt werden, heute hatten wir 31 Grad Lufttemperatur. Aus diesem Grund haben wir die Ladeluken geöffnet, der Fahrtwind kühlt auch. Schokolade darf nicht wärmer werden als 15 Grad, für Medikamente liegt die Grenze bei 20. Wenn das überschritten wird, haben wir ein Problem – ein ziemlich großes sogar. Die Temperaturregelung funktioniert über Kühlaggregate an jedem einzelnen Container und dazu braucht es Strom."
"Jeder einzelne Container hängt am Strom und kann individuell geregelt werden?"
"Ja."
"Ist das nicht ein bisschen umständlich?"
"Mit der Regelung der Temperatur haben wir nichts zu tun, das machen sie im Hafen mit dem Computer. Wir müssen nur für die Stromzufuhr sorgen."
"Und was ist über Nacht, wenn die Maschine gar nicht läuft?"
"Unser Strom kommt nicht von der Hauptmaschine, dafür ist der Verbrauch zu groß. Für die Stromproduktion haben wir einen eigenen Generator, der auch nachts läuft, den Jokel. Ich zeige ihn dir, wenn wir im Maschinenraum sind."
Читать дальше