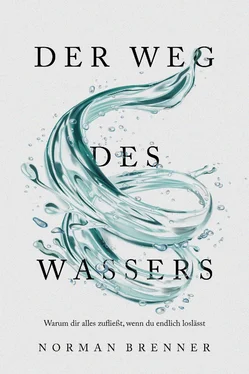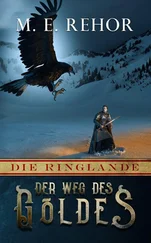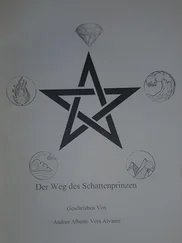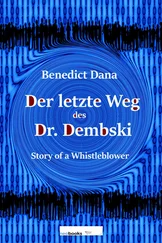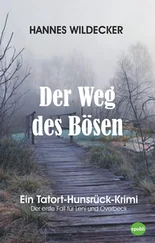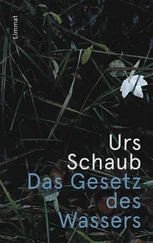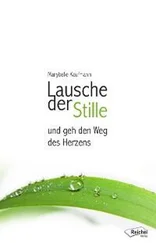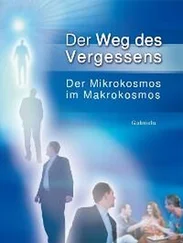Was für das Star Wars Universum gilt, gilt auch für unsere Galaxie. Im Grunde könnten wir es sogar darauf beschränken, dass es eine ganz bestimmte Angst ist, die hinter unseren Problemen und dem Festhalten steht: die Verlustangst.
Die eine Angst, die hinter allen anderen steckt
Es ist egal, ob es um den Verlust von Ansehen, Materiellem, deinem Partner, deinem Leben oder einfach nur deinem Wohlbefinden geht: Die Gefahr, etwas liebgewonnenes zu verlieren, macht Angst. Und genau diese Verlustangst nehmen wir im folgenden Kapitel unter die Lupe. Zuvor, die Zusammenfassung:
» Hinter jedem Problem in deinem Leben steckt am Ende eine Angst.
Angst ist an sich nichts Schlechtes. Sie half und hilft uns, zu überleben.
Wir können die intuitive Angst (Furcht) bei akuter Bedrohung von der rationalen Angst (Sorgen) unterscheiden, die wir uns selbst im Geiste schaffen.
Da das Überleben früher von vielen äußeren Bedingungen abhängig war, überlebten jene Individuen, die sich mehr Sorgen machten (z. B. „Wird die Ernte reichen?“).
Deshalb neigen wir Menschen auch heute noch dazu, uns Sorgen zu machen. Wir stammen von den sorgenvollsten unserer Art ab.
Die Umstände haben sich heute aber geändert und unsere Fähigkeit, uns zu sorgen, bereitet uns heute Leid.
Ängste und Sorgen sind die Ursache für unsere Negativität und damit am Ende für unser Festhalten und all unsere Probleme. Sie sind wie die Erdmasse, die die Schwerkraft erzeugt, die das Wasser der Flüsse am Boden und in seinen Bahnen hält.
Hinter jedem deiner Probleme steht am Ende also eine Angst.
Diese Angst lässt sich sogar genauer eingrenzen, denn in 100 % der Fälle ist es eine Verlustangst, die auf unseren Überlebensinstinkt zurückgeht.
Was ist die Angst hinter deinem aktuell größten Problem? Wie lässt sie sich auf die Angst vor dem Tod zurückführen?
Die Urangst hinter allen Ängsten
„Was du bekommst, nimm ohne Stolz an, was du verlierst, gib ohne Trauer auf.“
(Marc Aurel)
Die Angst vor Verlust ist der Quell all unserer anderen Ängste, unserer Negativität und schließlich auch unseres Leidens. Aber warum?
Warum die Verlustangst hinter all unserem Leid steckt
Ein anschauliches Beispiel, dafür, wie Verlustangst uns dazu bringt, dass wir freiwillig am Leid festhalten und nicht loslassen können oder wollen, ist die sogenannte Verlustaversion.
1) Verlustaversion – warum wir festhalten, was uns schadet
Wenn die Angst darüber, etwas bereits Erreichtes zu verlieren, größer ist als die Freude darüber, etwas Neues in mindestens gleicher Höhe zu gewinnen, spricht man von einer Verlustaversion. Hört sich sehr theoretisch an, aber du kennst das auch: Wenn du 50 Euro verlierst, ärgerst du dich mehr, als du dich darüber freuen würdest, 50 Euro zu finden.
» Die Verlustaversion ist unsere Neigung, Verluste höher zu gewichten als Gewinne.
Kommt dir das bekannt vor? Richtig, hier spiegelt sich unser Hang zur Negativität wieder. Wegen dieser Abneigung (Aversion) gegen Verluste …
hängen wir an festgefahrenen Gewohnheiten, auch wenn wir lieber etwas anderes machen würden
klammern wir an unserem Partner, auch wenn wir wissen, dass wir damit der Beziehung schaden
quält uns alleine schon der Gedanke, ein Stück von unserem Besitz wieder abgeben zu müssen
halten wir fest am ungeliebten Job, auch wenn wir genau wissen, dass er uns todunglücklich macht …
Du hast doch schon so viel reingesteckt! In die harte Ausbildung, das Ertragen der schrecklichen Kollegen, die vielen Gefälligkeiten für den Chef! Es entsteht eine „kognitive Dissonanz“. So nennen Psychologen es, wenn in uns eine innere Spannung zwischen dem, was wir tun wollen oder sollten, und dem, was wir tatsächlich tun, entsteht. Zum Beispiel wenn du weiter an deinem ungeliebten Job festhältst, obwohl du genau weißt, dass du hier nie glücklich werden wirst. Das, worin du investierst, muss einfach gut sein. Wir könnten die kognitive Dissonanz auch als Zerrissenheit oder „Herz gegen Kopf“ bezeichnen. Der Kopf will das eine, das Herz etwas anderes. Kennst du sicher. Und leider folgen wir hier viel zu oft dem Kopf. Damit machen wir uns das Leben selbst zur Hölle. Und das alles nur aus Angst. Aus der Angst heraus, etwas zu verlieren, das wir zu unserem Glück gar nicht brauchen. Sogar, wenn wir es eigentlich besser wissen müssten und alle Fakten dagegen sprechen, halten wir wegen dieser Angst, unsere bisherige Investition zu verlieren, fest. Und das betrifft nicht nur dich und mich als einzelne Menschen. Gesellschaften, Firmen und sogar ganze Länder sind kollektiv von diesem Phänomen betroffen. Ein herausragendes Beispiel für die Verlustaversion in großem Stil war zum Beispiel das Concorde-Projekt.
Was uns das Concorde-Projekt über unsere Verlustangst lehrt
Du erinnerst dich? Das schnellste Passagierflugzeug der Welt. 40 Jahre lang hielten die britische und die französische Regierung an diesem Projekt fest.
„Wo ist das Problem?“ , denkst du jetzt wahrscheinlich …, „war doch ganz erfolgreich!“ Eben nicht. Die Concorde hat fast durchgehend Verluste eingefahren. Von Jahr zu Jahr. 40 Jahre lang. Warum hat man dann solange an ihr festgehalten? Wegen der Aversion gegen den Verlust des bereits investierten Kapitals. Die Anfangsinvestition in dieses Projekt war etwa eine Milliarde Dollar und die sogenannten „versunkenen Kosten“ damit immens.[Fußnote 10] So eine Summe schreibt man nicht gerne ab.
» Je höher die versunkenen Kosten bei einem Verlust sind, desto heftiger wehren wir uns gegen das Loslassen.
Das ist dasselbe Phänomen, wie wenn du ein altes Auto hast, das jeden Monat Hunderte oder Tausende Euros an Reparaturkosten verschlingt. Du weißt, dass du eigentlich ein neues kaufen solltest, aber du hast schon so viel in diesen Wagen investiert! Und vielleicht hört das mit den Reparaturen ja endlich im nächsten Monat auf. Aber es hört nicht auf und am Ende hast du sogar mehr Geld in dein altes Auto gesteckt, als ein neues gekostet hätte. Nun kommt einer und bietet dir 500 € dafür. Kannst du diesen Preis annehmen? Nein, denn das Auto ist für dich logischerweise viel mehr wert. Aus diesem Grund wurde auch immer mehr Geld in das Projekt Concorde hineingepumpt. Du kannst dir ja sicher vorstellen, dass mit jedem Euro, der hineinfloss, die Verlustaversion größer wurde, weil die Summe des potenziellen Verlustes immer weiter stieg. So dauerte es 40 Jahre, bis die Kosten schließlich so unvertretbar hoch wurden, dass man endlich auf die Idee kam, das Projekt einzustellen und es loszulassen. An diesem Beispiel lassen sich aber noch zwei weitere Phänomene beobachten, die uns das Loslassen so schwer machen …
2) Der Eigentumseffekt – warum etwas wertvoller ist, wenn es dir gehört
Alleine der Umstand, dass uns etwas „gehört“, erhöht den Wert dieser Sache in unseren Augen immens. Nimm das alte Auto von eben. Als Außenstehender würdest du dem Besitzer vielleicht auch nur ein paar hundert Euro dafür bieten. Aber wenn dir das Auto selbst gehört, ist es auf einmal ungleich wertvoller für dich und ein paar Tausend Euro müssten es da schon sein. Nun stell dir doch einmal vor, du könntest behaupten, dir gehöre das schnellste Passagierflugzeug der Welt. Würdest du diesen Umstand gerne ändern? Vermutlich nicht. Doch wir müssen nicht auf so extreme Beispiele wie die Concorde zurückgreifen, um den Eigentumseffekt in unserem Leben zu beobachten. Du kannst es täglich sehen, auf jedem Flohmarkt, auf eBay oder beim Gebrauchtwagenkauf:
Читать дальше