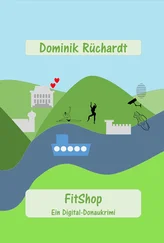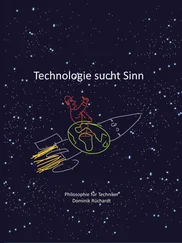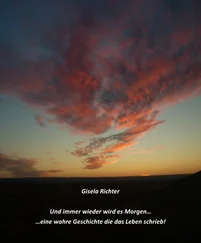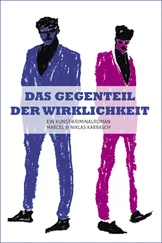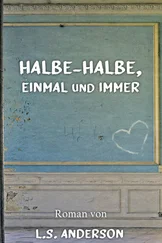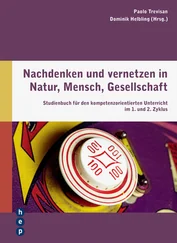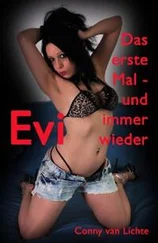Die Geschichte von Adam und Eva enthält noch viel mehr tiefgründige Erkenntnis. Offenkundig hatte Gott zunächst eine Art Puppenhaus im Sinn. Eine geschlossene, heile, konfliktfreie Welt. Warum er den Baum der Erkenntnis mit hineinsetzte, ist nirgendwo erklärt. Es ist zu vermuten, er fand, die Puppenwelt sei ohne ein solches Risiko belanglos. Um sich jedoch abzusichern, sprach er das erste Verbot aus: Die beiden durften nicht vom Apfelbaum essen. Das war widernatürlich. Das Verbot, das Gott gesetzt hatte, war ein reiner Machtanspruch.
Eine Frechheit. Eva hatte völlig Recht, sich zu widersetzen. Und dann kam alles ganz anders, als Gott es sich mit den Menschen vorgestellt hatte. Das Leben begann. Das sich Herumschlagen mit der Erkenntnis und ihren Lasten. Die Hybris, das Zweifeln, das Entwickeln von Ideen und das Anfeinden von Ideen. Die Puppenhausidylle verwandelte sich in ewiges Probieren, in Liebe und Gewalt, Hoffnung und Verderben.
Aus dem geschlossenen Raum des Paradieses wurde ein offenes Universum, in dem stets alles anders kommt, als erwartet. Warum es so ist, das scheinbar jede Handlung zum Gegenteil dessen führt, was sie bewirken sollte, das erklärt die Gegenteilstheorie - und dass das gar nicht so schlimm ist, davon handelt dieses Buch.
Bei der Gegenteilstheorie geht es um Handlungen und ihre Folgen. Und Handlungen sind das Ergebnis von Entscheidungen.
Entscheidungen fallen nicht aus sich heraus. Entscheidungen fallen stets in einer Umgebung, einem Raum oder System, welche das Abwägen der Entscheidung beeinflusst und die wiederum in der Regel durch die Entscheidung beeinflusst wird. Dabei machen Entscheidungen, also die Fähigkeit zu einem unerwarteten Verhalten, im Wesentlichen das aus, was wir Leben nennen.
Doch die Räume oder auch Systeme, in denen wir uns bewegen, sind etwas schwer Greifbares. Das liegt daran, dass wir jeweils einen großen Teil dieser Räume gar nicht kennen oder verstehen. Um dem abzuhelfen, konstruieren wir uns für gewöhnlich kleinere Räume, auf die wir unsere Wahrnehmung beschränken und mit denen wir besser zurechtkommen. Mit diesen Räumen möchte ich mich zunächst beschäftigen, bevor ich zur Frage komme, was es mit den Entscheidungen und Handlungen in diesen Räumen auf sich hat.
Zuallererst geht es dabei um das Universum als Raum, der unser Dasein bestimmt. Dessen Unfassbarkeit beschreibt Karl Popper in „Alles Leben ist Problemlösen“ mit Hilfe einer sich selbst darstellenden Karte. Damit setzt er einen Rahmen für alles Leben und damit auch für alle Entscheidungen die darin stattfinden:
„ Eine Karte, die eine Karte von sich selbst enthalten soll, lässt sich nicht vervollständigen. (… Dies) zeigt die Unvollständigkeit und Offenheit eines Universums. (…) je kleiner die Striche werden, zu denen der Zeichner kommt, desto größer wird die relative Ungenauigkeit sein, die im Prinzip unvorhersagbar und indeterminiert ist und stetig zunimmt.( …) dieses Beispiel zeigt, warum eine erklärende Wissenschaft niemals vervollständigt werden kann; denn um sie zu vervollständigen, müssten wir eine Erklärung von ihr selbst geben.“
(Popper, 1996)
Das Universum als größter für uns wahrnehmbarer Raum ist also offen und nicht darstellbar. Die Einschränkung, dass wir hier von einem aktiven Universum ausgehen, also einem, in dem sich Dinge verändern, ist dabei nicht relevant. Wäre ein Universum unbewegt, würde das mit der Karte durchaus funktionieren, aber damit wäre das Universum tot und enthielte kein Leben.
Wir wollen im Weiteren davon ausgehen, dass das Universum nicht tot ist. Was es nun bedeutet, wenn sich in diesem offenen Raum Leben befindet beschreibt Popper wenig später im gleichen Werk:
„ Probleme und Problemlösungen scheinen zusammen mit dem Leben entstanden zu sein. … (wir können nicht) ... sagen, dass für Atomkerne das Überleben in irgendeinem Sinne ein „Problem“ ist. … Das Leben jedoch ist mit dem Problem des Überlebens von Anfang an konfrontiert, ja, wir können, wenn wir wollen, das Leben als Problemlösen schlechthin beschreiben und die lebenden Organismen als die einzige problemlösenden Komplexe im Universum.“
Und im gleichen Werk schreibt er wenig später:
„ Angenommen, wir haben in einem (Reagenzglas) Leben erzeugt, und zwar in Form eines Gens oder mehrerer Gene … dann ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass dieses von uns erzeugte Leben weiterleben wird. Und zwar deshalb, weil kein Grund vorliegt, anzunehmen, dass dieses Leben, das wir erzeugt haben, dem (Reagenzglas) angepasst ist.
Ein (Reagenzglas) ist eine sehr arme Umgebung für das Leben, und um das Leben am Leben zu erhalten, werden wir anfangen müssen, eine Maschinerie zu entwickeln. Wir werden also die Umgebung an das Leben anpassen müssen. … (und) zunächst will ich darauf aufmerksam machen, dass die bloße Entstehung von Leben noch überhaupt kein Problem löst.“
Und wenige Seiten darauf überträgt er die Überlegungen vom einzelnen Gen auf die Urtiere und damit auf alles was folgt:
„ (Die Urtiere) … machen Probierbewegungen … und versuchen, irgendetwas irgendwie zu optimieren. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Probierbewegungen um gefühlsmäßiges Abwägen. Aber vielleicht auch um gar nichts Psychisches, sondern nur darum, was für den Mechanismus, den sie auch darstellen, das Beste ist. Sie suchen und sie finden; sie sind auf der Suche nach einer besseren Umgebung, nach einer besseren Welt, schon die Urtiere.“
Wir haben es nach der Erkenntnis Karl Poppers also, sofern wir von der Existenz von Leben ausgehen, mit einem offenen Universum zu tun, das wir niemals vollständig darstellen können. Das wir also auch niemals in seinen Gesetzmäßigkeiten und Verhaltensweisen vollständig beschreiben können. Zudem haben wir bei den Kräften des Lebens zwei wesentliche Eigenschaften: Eine unglaubliche Hartnäckigkeit in der Veränderung und im Ausprobieren - und ein kompromissloser Drang, auch die Umwelt im Sinne der eigenen Überlebensfähigkeit anzupassen.
Das Interessante an Popper ist unter anderem, dass er, im Gegensatz zur Philosophie der zwei Jahrtausende vor ihm, nicht darüber nachdenkt, ob Gott existiert und warum, sondern dass es ihm egal ist. Dass er die Welt aus ihrem Dasein heraus denkt und nicht aus dem Versuch, sie von außen zu erklären. Das ist auch im Weiteren für dieses Buch ein entscheidender Unterschied.
Noch vor den Überlegungen Poppers fanden Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in der Physik bahnbrechende Erkenntnisse statt, die das klassische Weltbild, das im Wesentlichen auf der Newtonschen Mechanik beruht hatte, nachhaltig veränderten.
Stephen Hawking fasst die Erkenntnisse in seinem Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ zusammen. Die für die Gegenteilstheorie wichtige Kernaussage ist die Heisenbergsche Unschärferelation, aus der sich die Erkenntnis ableitet: „Um den Zustand des Universums zu beobachten, muss ich es beeinflussen.“ (Hawking, Eine kurze Gechichte der Zeit)
Hawking beschreibt die Zusammenhänge sinngemäß: Konkret geht es dabei darum, Position und Geschwindigkeit eines Quantums, der kleinsten Energieeinheit einer Lichtwelle, zu messen. Die einzige Möglichkeit, es zu messen, ist mit einem Lichtstrahl, der wiederum die kleinstmögliche Wellenlänge, nämlich die eines Quantums benötigt. Wie dieser Lichtstrahl nun auf das Quantum auftrifft, verfälscht entweder das Ergebnis der Position oder das Ergebnis der Geschwindigkeit. Es ist also nicht möglich, ein exaktes Ergebnis zu erhalten. Das ginge nur für ein übernatürliches Wesen, das außerhalb des Universums und seiner Gesetzmäßigkeiten steht. (…)
Die Physiker um Heisenberg, Schrödinger und Dirac haben sich daher vom Bild eines deterministischen Universums verabschiedet und die Quantenmechanik eingeführt, in der ein Teilchen nicht mehr eindeutig mittels Position und Geschwindigkeit gemessen werden muss, sondern in der eine Kombination beider Eigenschaften genügt. Die Quantenmechanik zeigt bei Messungen nicht mehr exakt Ergebnisse an, sondern eine Reihe möglicher Resultate und deren Wahrscheinlichkeit. (…)
Читать дальше