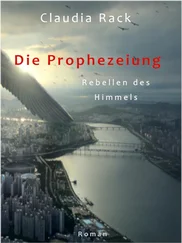Claudia Rimkus
Die weiße Villa
Im Netz des Wahnsinns
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Claudia Rimkus Die weiße Villa Im Netz des Wahnsinns Dieses ebook wurde erstellt bei
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Impressum neobooks
2003
Tagelang hatte ein heftiger Orkan über Roraima im Norden Brasiliens gewütet und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Heftige Regenfälle, Erdrutsche und Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Strommasten hatten im gesamten Bundesstaat für Chaos gesorgt. Hütten lagen in Trümmern, Telefonleitungen funktionierten nicht mehr. Rettungskräfte waren ständig im Einsatz.
Das kleine aus den Balken mächtiger Urwaldriesen erbaute Buschkrankenhaus hatte dem Sturm ohne größere Schäden widerstanden. Für viele Menschen aus der Umgebung war es der einzige erreichbare Zufluchtsort. Die nächste Ortschaft Alto Alegre lag viel zu weit entfernt, um sie gefahrlos zu erreichen. Die Schutzsuchenden saßen bei den Patienten in den Krankenzimmern oder lagen auf den Fußböden in den Fluren. Hier fühlten sie sich sicher. Die meisten von ihnen waren im Laufe des Abends vor Erschöpfung eingeschlafen.
Unweit des Hospitals lehnte ein Mann in der Dunkelheit an einem Pickup. Er war ganz in schwarz gekleidet und lauerte im Windschatten des Wagens. Ungeduldig blickte er abwechselnd auf die Leuchtziffern seiner Armbanduhr und zum Hospital hinüber. Der Sturm hatte etwas nachgelassen und es regnete nicht mehr. Dennoch fühlte sich der Mann sicher vor Entdeckung. Abermals warf er einen Blick zur Uhr. Bisher war alles nach Plan verlaufen. Allmählich müsste in der Klinik Ruhe einkehren. Niemand würde ihn stören.
Er blickte sich noch einmal nach allen Seiten um. Kein Mensch weit und breit. Ohne Eile ging er um den Wagen herum und nahm die beiden großen Benzinkanister von der Ladefläche. Damit schlich er geduckt zur Rückseite der Klinik. Einen der Blechkanister stellte er neben einem Busch ab und öffnete dann den Verschluss des anderen.
Während er die Flüssigkeit gegen die Außenwände spritzte, verschwendete er keinen Gedanken an die Menschenleben, die er in dieser Nacht auslöschen würde. Das war ein Job für ihn – ein lukrativer dazu. Skrupel kannte er nicht. Es war nicht sein erster Auftrag dieser Art. Deshalb wusste er genau, an welchen Stellen des Gebäudes er den Brandbeschleuniger einsetzen musste. In der Nähe der Fenster war er besonders vorsichtig, um nicht zufällig gesehen zu werden.
Als er beide Kanister geleert hatte, schlich der Mann zu seinem Wagen zurück und tauschte sie gegen zwei gefüllte aus, um auch sie in der näheren Umgebung der Klinik auszugießen. Zuletzt verschüttete er noch eine dünne Spur, die nicht weit von seinem Fahrzeug an einem Pfeiler endete. Die leeren Kanister stellte er auf die Ladefläche zurück und zog eine Plane darüber.
Hastig stieg er in seinen Wagen, startete und lenkte ihn über die holprige, vom Regen aufgeweichte Erdpiste bis unter eine Baumgruppe in der Nähe. Hier würde ihn niemand aufspüren.
Nervös trommelten seine Fingerspitzen auf dem Lenkrad. Dabei beobachtete er das Satellitentelefon auf der Ablage, das sein Auftraggeber ihm zur Verfügung gestellt hatte.
Der Typ hatte an alles gedacht. In dieser abgelegenen Gegend gab es kein Handynetz. Nur über das Satellitentelefon konnten sie Verbindung zueinander aufnehmen. Plötzlich leuchtete das Display des Telefons auf. Gleichzeitig ertönte ein leiser Klingelton – einmal, zweimal. Dann war es vorbei. Im Stillen zählte der Mann langsam bis dreißig.
Wie abgesprochen, läutete es abermals: einmal - zweimal - dreimal - viermal – und verstummte. Das verabredete Signal!
Ohne zu zögern, stieg er aus dem Wagen. Um kein unnötiges Geräusch zu verursachen, lehnte er die Tür nur an und lief zu der Stelle zurück, an der die Benzinspur endete.
Mit dem Rücken zum Wind blieb er stehen und zog einen Fidibus und ein Zippo mit einem Phoenixemblem aus der Jackentasche. Rasch blickte er sich noch einmal um, bevor er in die Hocke ging und den Deckel mit dumpfem Klacken öffnete. Mit dem Daumen drehte er das kleine Rädchen neben dem Docht. Sofort sprang ein Funke über.
Schützend hielt der Mann seine Hand vor die Flamme und entzündete das Holzstückchen, bevor er es auf die benzingetränkte Erde fallen ließ. Augenblicklich brannte der Boden.
Während der Mann zu seinem Wagen zurücklief, bahnten sich die Flammen der Spur entlang ihren Weg.
Aus sicherer Entfernung beobachtete der Brandstifter sein Werk. Im Nu war die Klinik vom Feuer eingeschlossen. Angefacht vom Wind, fraß es sich immer schneller an das Gebäude heran. Dunkle Rauchschwaden stiegen in den Himmel. Es roch nach verbranntem Holz.
Die Menschen in dem kleinen Krankenhaus wurden im Schlaf von den Flammen überrascht. Die meisten erstickten im dichten Rauch. Einem Mann gelang es, dem Inferno zu entkommen. Wie eine lebende Fackel wankte er ins Freie. Seine gellenden Schreie durchschnitten die Nacht. Verzweifelt warf er sich auf die Erde, wälzte sich herum, aber die wütenden Flammen waren stärker. In gekrümmter Haltung blieb er liegen.
Bis auf die Grundmauern brannte das Buschkrankenhaus ab. Es gab keine Überlebenden. Den Rettungskräften, die am Morgen eintrafen, bot sich ein Bild des Grauens und der Zerstörung. Für die Menschen kam jede Hilfe zu spät. Man konnte nur versuchen, ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern, das längst auf die umstehenden Bäume übergegriffen hatte. Durch den heftigen Wind fanden die Flammen stetig neue Nahrung. Erst nach drei Tagen gelang es, die letzten Feuer zu löschen.
2011
Beim Landeanflug konnte man aus dem Flugzeug tief unten die satten Farben der Wiesen und Felder sehen. Obwohl Brigitte Gundlach auf einem Fensterplatz saß, hielt sie die Augen geschlossen. Sie war müde und erschöpft. Nicht nur der lange, anstrengende Flug von São Paulo und das Umsteigen in Frankfurt waren der Grund. Auch dass sie wieder keine Spur von ihrem Sohn entdeckt hatte, machte ihr zu schaffen. Alljährlich reiste sie kreuz und quer durch Brasilien, um nach ihm zu suchen. Schon seit acht Jahren galt er als verschollen. Damals war das kleine Buschkrankenhaus, in dem er als Arzt gearbeitet hatte, bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Obwohl es angeblich keine Überlebenden gab, war Brigitte fest davon überzeugt, dass ihr Sohn noch lebte.
Nervös wartete ihr Neffe im Flughafenterminal Hannover-Langenhagen auf die Ankunft der Maschine. Sein Blick wechselte immer wieder zwischen der Uhr und der Anzeigetafel.
Endlich erschien auf dem Monitor die Information, dass der Flieger aus Frankfurt gelandet war.
Unwillkürlich umfasste er den üppigen Rosenstrauß fester und hielt durch die Glasscheiben der Abfertigung Ausschau nach seiner Tante. Er musste sich eine Weile gedulden, bis die schlanke Gestalt, die einen Gepäckwagen vor sich herschob, die Ankunftshalle betrat.
Читать дальше