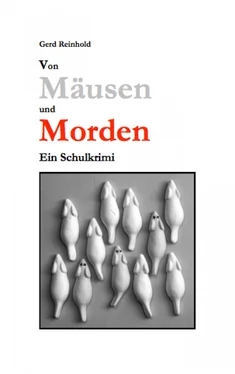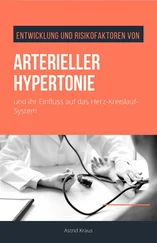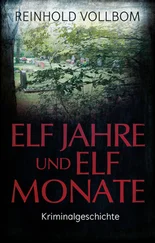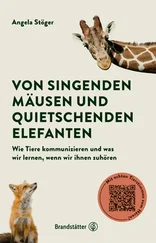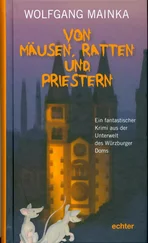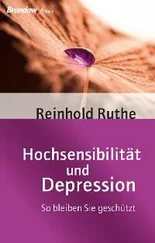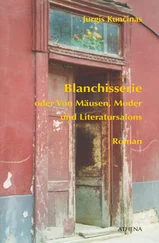»Ich glaube, es geht um einen Text, geschrieben entweder aus der Perspektive eines Inklusionsschülers oder aus der eines Normalos über das Thema«, pries sie weiter den Wettbewerb an.
Die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen aber blieb verhalten. Man saß als Gruppe von zwölf Personen in einem Klassenzimmer um einige zusammen geschobene Tische herum.
»Ich geb´ euch das `mal `rum«, beendete Ingeborg ihre Werbeaktion, und ihrer Stimme war ein wenig Resignation anzumerken, nicht aber ihrem üblichen Pokerface, während sie das Blatt Papier an den neben ihr sitzenden Kollegen gab, um sogleich zum nächsten derartigen Angebot überzugehen.
Zu früheren Zeiten, als Fachleiter noch Fachvertreter geheißen hatten und nicht nur besser als heute für ihre Funktion entschädigt worden waren, sondern vor allem die Interessen des Faches vertreten hatten und nicht als verlängerter Arm der Schulleitungen deren Interessen bezüglich des Faches durchsetzen sollten, hatten solche Fachkonferenzen stattgefunden, wenn die Fachvertretung oder die Fachkollegen das Bedürfnis danach gehabt hatten, weil es etwas zu besprechen, zu beschließen, zu verteilen oder zu klären gegeben hatte. Zum Beispiel, wer im folgenden Schuljahr welche Lerngruppe in dem Fach unterrichten sollte oder welche neuen Schulbücher im Fach angeschafft werden sollten.
Dies waren zwar immer noch wichtige Themen von Fachkonferenzen, aber seit deren Termine und Dauer von der Schulleitung festgelegt wurden, brauchte man als Fachleitung auch »Füllthemen«. Deswegen war man gerade bei dem Tagesordnungspunkt »Veranstaltungen, Wettbewerbe und sonstige Angebote« angekommen, der bei den anwesenden Fachkolleginnen und -kollegen in etwa soviel Begeisterung auslöste wie im Hochsommer ein im Pool treibendes Brathähnchen. Interesse? Grundsätzlich schon. Näheres Interesse? Lieber nicht. Die Kollegen kannten ja ihre Schüler: Etwas schreiben? Ja, wenn es denn sein muss (zum Beispiel bei Klassenarbeiten). Sonst galt eher: Lass `ma stecken, ey! Für einen Preis, den man gewinnen kann? Ja, vielleicht..., aber wie hoch ist der denn? Nach in der Regel utopischen Vorstellungen über die Höhe des Gewinns, des sogar nur möglichen Gewinns, war das Thema meistens durch. Außerdem standen doch sowieso meist irgendwelche Prüfungen, Klausuren, Klassenarbeiten, Überprüfungen, Lernstandstests oder Ausgangslagentests und sonstige Leistungsmessungen für die Schüler an. Da konnte kaum noch Motivation für zusätzliche Herausforderungen und Leistungen aufkommen, fand Hieronymus und fand es zugleich umso bewundernswerter, wenn dann doch so etwas zustande kam.
Die Teilnahme an irgendwelchen Veranstaltungen, wie sie auch auf solchen Fachkonferenzen angepriesen wurden, hatte ebenfalls einen Pferdefuß. Wenn dafür Regelunterricht ausfallen musste, so war das zwar eine willkommene Abwechslung für Schüler und Unterrichtende, aber beide mussten das Versäumte meist nacharbeiten. Siehe oben: Prüfungen, Klausuren, Klassenarbeiten, Überprüfungen, Lernstandstests, Ausgangslagentests... Fiel aber kein Unterricht für die Teilnahme an besonderen Veranstaltungen aus, so bedeutete das natürlich eine zusätzliche zeitliche Inanspruchnahme. Viele ältere Schüler jobbten nachmittags beziehungsweise am Wochenende, da waren dann zeitliche Konflikte unvermeidlich. Und weil die Arbeitszeit für Lehrer im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich direkt und indirekt erhöht worden war, fanden viele nicht mehr die Zeit und die Motivation für zusätzliche zeitliche Aufwendungen. Hieronymus sah sich um in der Runde der Kollegen. Wie viele von ihnen würden wohl jetzt gerne woanders sein wollen, um etwas zu tun, was für sie wichtiger war? Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen oder nur die notwendige Rekonstruktion ihrer Arbeitskraft, als welche sogenannte Freizeit inzwischen ja gar nicht mehr gesehen werden sollte. Seit der Verordnung zur Lehrerarbeitszeit aus dem Jahr 2003, verharmlosend als »Lehrerarbeitszeitmodell« bezeichnet, war die Teilnahme an Fachkonferenzen und Jahrgangskoordinationen auch ein faktorisierter Bestandteil des offiziellen Summenspiels der Lehrerarbeitszeit. Also musste diese Zeit abgesessen werden, ob gerade Bedarf dafür bestand oder nicht, und die Schulleitungen waren in der Pflicht zu planen und zu kontrollieren, dass dieser Anteil der Lehrerarbeitszeit tatsächlich abgesessen wurde.
Hieronymus saß gerade ab und saß wie auf Kohlen, denn er sehnte das Ende der Veranstaltung herbei, weil er ja anschließend noch einen nichtschulischen Hausbesuch machen wollte. Im wahrsten Sinne des Wortes wollte er ein Haus besuchen, aber nicht dessen Bewohner, und das nicht im beruflichen, sondern im privaten Interesse. Und je früher die derzeitige Veranstaltung zu Ende wäre, desto weniger hätte er sich nachher durch den Berufsverkehr zu kämpfen.
Beachtliches Interesse in der Runde fand das abschließend vorgestellte Werk eines Schulbuchverlages mit dem Titel »Überleben an der Haupt-, Mittel- und Gesamtschule«. Und auch für die beiden Hefte mit dem Titel »Zusatzaufgaben für Unterrichtsstörer« (Untertitel: »Schnell und wirkungsvoll reagieren - zur Selbstreflexion anregen«) konnten sich einige der Kolleginnen und Kollegen offenbar erwärmen.
Für die unmittelbar nachfolgende Jahrgangskoordination im Fach Deutsch hatte Hieronymus sich einem der Jahrgänge zuzuordnen, in denen er das Fach derzeit unterrichtete. Weil der Jahrgang Dreizehn schon im Abitur steckte und keinen Unterricht mehr hatte, den man noch koordinieren könnte, und der Jahrgang Zehn nur noch für die mündlichen Abschlussprüfungen lernte, in welche sich Hieronymus von anderen nicht gerne hineinkoordinieren ließ, blieb nur noch der Jahrgang Neun für ihn übrig, in dem er mit den Kolleginnen und Kollegen koordinieren konnte.
Das war aber insofern auch eine Flucht von Hieronymus, als es durchaus Kollegen gab, die gerne gerade im Jahrgang Zehn sowohl die Vorbereitung des Prüfungsthemas im Unterricht als auch möglichst jede einzelne Aufgabe und Frage der Prüfung selbst dezidiert bis ins Detail mit den anderen beteiligten Kollegen, also auch mit Hieronymus, diskutiert, begutachtet, verworfen, verändert, abgesprochen und festgeklopft hätten. Hieronymus aber hasste so etwas, weil er der Meinung war, dass ihn das sowohl in der unterrichtlichen Vorbereitung der Prüfungen als auch in den Prüfungen selbst zu etwas degradiert hätte, was man ebenso einer Maschine übertragen könnte (und künftig wohl auch wird). Zum bloßen Abarbeiten eines vorgegebenen festen Programms nämlich. Spontanität und Kreativität bei der Reaktion auf sein Gegenüber, die Schüler, wären dabei seiner Meinung und Erfahrung nach kaum noch möglich oder zumindest sehr erschwert. Frei nach Lenins angeblicher Devise »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser«, die sich nach Hieronymus´ Ansicht in der Personalführung des Hamburger Schulwesens offenbar weitgehend durchgesetzt hatte (obwohl man von Lenin dort sonst wohl eher weniger hielt), lautete die seine »Planung ist gut, Interaktion ist besser.«
Als nun die vier Kollegen, die derzeit im Jahrgang Neun nicht nur Deutsch unterrichteten, sondern bei der heutigen Jahrgangskoordination auch in diesem Jahrgang anwesend waren und nicht in einem anderen, vorstellten, was sie gerade im Unterricht machten, berichtete Hieronymus:
»Also, ich bin noch ein ganzes Weilchen bei den Kurzgeschichten.«
»Und danach, was wirst du dann machen?«, fragte Christin Solcka, eine Kollegin der Sorte »Thirtysomethings« (sie hatte gerade erst ihren dreiunddreißigsten Geburtstag gefeiert) interessiert.
»Na ja, zum Abschluss des Schuljahres könnte man `mal wieder ein bisschen Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung wiederholen«, meinte Hieronymus, dachte dabei an die s-Laute und sah einige der Kolleginnen und Kollegen zustimmend nicken.
»Das hab´ ich schon am Anfang des Halbjahres gemacht«, bemerkte der Kollege Günther Liebensgut lakonisch, was aber nicht arrogant oder nur herablassend gemeint war, sondern nur seiner nüchternen Art entsprach.
Читать дальше