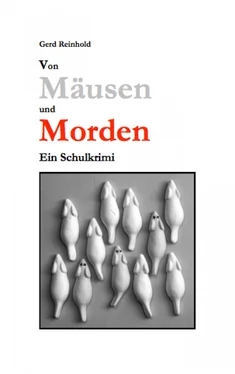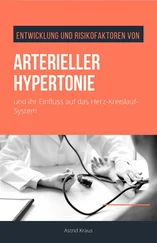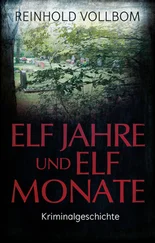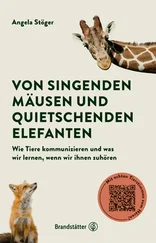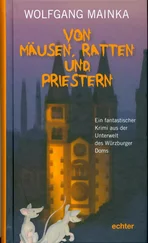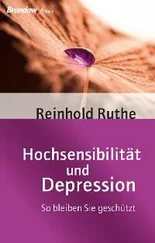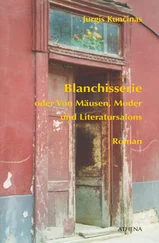Hieronymus hatte an diesem Tag kein Erlebnis der besonderen Art in diesem Klassenraum mit der umgedrehten Einrichtung während seiner Doppelstunde Deutsch. Der Kurs aus dem Jahrgang Neun war ähnlich wie seiner aus dem ganzen zehnten Jahrgang aus allen neunten Klassen zusammengewürfelt und umfasste diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren bisher gemessene Leistungen versprachen, den Mittleren Schulabschluss und eventuell sogar das Abitur zu ermöglichen. Der Kurs enthielt demnach kaum Schüler, die in diesem Schuljahr die Prüfungen zum Ersten Schulabschluss abzulegen hatten, und auch nicht die schulbekannten »Knallchargen« des Jahrgangs. Trotzdem war das Arbeiten in diesem Kurs für Hieronymus aber noch nicht einfach.
»Sie haben ›Straße‹ mit ›ß‹ geschrieben!«
Das war Kevin, der bei diesem ungefragten und laut vorgebrachten Einwand auf die Tafel deutete. Er entsprach zwar eigentlich nicht seinem Namen (»Kevin« war für Hieronymus kein Name, sondern ein Programm, eine Ankündigung), indem er nicht jeden Blödsinn machte, der ihm einfallen konnte, sofern einem Kevin nach Hieronymus´ Ansicht überhaupt etwas einfallen konnte, sondern im Gegenteil ziemlich intelligent zu sein schien. Diese Intelligenz half ihm aber nicht dabei, den Lehrer nicht grundsätzlich als seinen Sparringspartner zu sehen, den man verbessern musste, wo immer es scheinbar bei vermeintlichen oder tatsächlichen Fehlern Sinn zu machen versprach. Und den man für dümmer halten konnte, als man selbst zu sein sich zugestand, indem man glaubte, dass er es nicht bemerke, wenn man schummelte oder betrog.
»Ja und?«, fragte Hieronymus, anstatt Kevin darauf hinzuweisen, dass er wieder einmal einfach etwas in den Raum gerufen hatte, als Hieronymus der Klasse bei seinem Tafelanschrieb den Rücken zugekehrt hatte.
Die Kreidetafel befand sich zum Glück an der richtigen Wand, der Klasse zugewandt - warum auch immer, während das Smartboard, das Hieronymus sowieso nie benutzte, hinter den Schülern an der Wand prangte.
»Das ›ß‹ gibt´s nicht mehr, stattdessen schreibt man jetzt ein doppeltes ›s‹«, verriet Kevin altklug, und es schien Hieronymus, als warte er jetzt geradezu darauf, dass die Mitschüler sich alle von ihren Plätzen erhoben, um ihm lobend dafür auf die Schulter zu klopfen, dass er diesem Herrn Bosch mal wieder Bescheid gesagt hatte.
Aber Hieronymus, der eigentlich nur ein kleines Beispiel an die Tafel hatte schreiben wollen und keine große Sache aus Kevins Belehrung machen wollte, nahm diesem sogleich den Wind aus den Segeln, so dass ihm die aufgeblasenen Wangen wieder zusammenfielen wie angestochene Luftballons - ein Schauspiel, das sich im Laufe der Zeit regelmäßig wiederholte, indem er mit möglichst unterkühlter Stimmlage die Belehrung beantwortete.
»Danke, Kevin, für den Hinweis, auch wenn der nicht regelkonform kam. Aber das ›ß‹ ist nicht abgeschafft, das gibt es immer noch. Denn ein doppeltes ›s‹ ersetzt seit der Rechtschreibreform ein ›ß‹ nur dann, wenn der davor befindliche Vokal kurz ausgesprochen wird, was bei dem Wort ›Straße‹ offensichtlich nicht gilt.«
Eigentlich war ja Rechtschreibung, speziell der Wörter mit s-Lauten, aktuell nicht das Thema, sondern es ging zur Zeit um die Interpretation von Kurzgeschichten. Nachdem Hieronymus dem Kurs in der vergangenen Woche die Kriterien dieser literarischen Gattung vorgestellt und erläutert hatte, hatten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe bekommen, den Text »Das Fenster-Theater« von Ilse Aichinger auf die Merkmale der Gattung hin zu überprüfen. Manche hatten schon deswegen Schwierigkeiten damit, weil sie gar nicht glauben mochten, dass es sich dabei um eine Kurzgeschichte handeln könne.
»Boah, so viel Text!«
Für die Generation SMS und WhatsApp war das bereits eine längere Geschichte, eine Art von Roman.
»Sie helfen immer nur den anderen!«, beschwerte sich Alicia, als Hieronymus später in der Doppelstunde gerade deren Platz verließ, um sich anderen Schülern helfend bei ihrem Schreiben zuzuwenden, nachdem er etliche Minuten bei Alicia verweilt hatte, weil diese in Schwierigkeiten bei einer der Fragen geraten war, die die Schüler zum Text bekommen hatten.
So wie Hieronymus einem Jungen mit dem Namen Kevin nur schwer vorurteilsfrei begegnen konnte, verhielt es sich auch bei Mädchen, denen man den Namen Chantal angetan hatte (wegen des Verdachts auf »geistige Grundarmut«). Eine solche gab es in seinem Kurs zwar nicht (bezogen auf den Namen, nicht aber auf die Art von Armut), aber dafür eben eine Alicia. Wenn es allein nach ihr gegangen wäre, dann hätte Hieronymus den Rest des Kurses hinaus geschickt zum »Chillen« und sich ausschließlich ihrer Unterstützung gewidmet. Aber wahrscheinlich hätte sie sich dann darüber beschwert, dass sie als die Einzige nicht »chillen« dürfe. Hieronymus indes bemerkte das Aufkommen einer Unruhe in dem Kurs, was darauf zurückzuführen war, dass viele mit den Aufgaben zum Text bereits fertig waren, beziehungsweise meinten damit fertig zu sein.
»Das versteh´ ich nich´«, war die häufigste Aussage, mit der sich Schüler an Hieronymus wandten, sobald er bei ihnen vorbeikam und manchen gegenüber den Einwand äußerte, ob das denn schon alles sei, was der oder dem Betreffenden zu dieser oder jener Frage eingefallen sei.
»Denk´ doch nochmal darüber nach!«, war dann auch der am häufigsten vorkommende Satz, wenn sich Hieronymus von einem Schüler ab- und dem nächsten zuwandte.
Er wusste ob der aufkeimenden Unruhe, dass er die Fragen zum Text in Kürze mit dem Kurs würde besprechen müssen, auch wenn noch nicht alle damit fertig waren. Er wusste aber auch, dass diese Besprechungsphase nicht allzu ausführlich ausfallen durfte, um nicht wiederum Unruhe zu erzeugen, weil viele Schüler sich kaum länger als einige Minuten auf bloßes Zuhören einlassen konnten, sondern dass ihr sehr bald und rechtzeitig neue Herausforderungen und Betätigungsmöglichkeiten würden folgen müssen, auch wenn einige Schülerinnen und Schüler noch hinterher hingen und mit den »alten« Aufgaben noch nicht zu Ende gekommen waren. Aber genau so war es nun einmal und sogar nur abgeschwächt in einem Kurs, der eigentlich viel weniger heterogen war als eine normale Klasse; die einen brauchten viel Zeit und Ruhe, auch wenn wiederum einige von diesen sich und andere immer wieder von der Arbeit ablenkten, während es für andere »Schlag auf Schlag« gehen und ein »Event« das andere ablösen musste. Schnelle, rasante Schnitte im Film wie beim Mainstream-Kino. Insofern eine ganz normale Arbeitssituation für Hieronymus und kein Erlebnis der besonderen Art.
5.
»Hier habe ich noch ein besonderes Schnäppchen für euch«, rief Ingeborg Seiffert in die Runde und hielt dabei ein Blatt Papier in die Höhe, obwohl natürlich so niemand darauf etwas lesen konnte.
Ihr war nicht anzumerken, ob das mit dem »Schnäppchen« ernst gemeint oder nur gut versteckte Ironie war. Beides war möglich bei ihr, denn Ingeborg befand sich in der zweiten Hälfte ihrer Fünfziger-Jahre und war abgeklärt genug inzwischen, alles in und bezüglich der Schule aus einem gewissen sicheren Abstand heraus zu betrachten.
»Ein Schreibwettbewerb zum Thema ›Inklusion‹«, fuhr sie fort, und wie Hieronymus Ingeborg kannte, konnte sie ihrem Angebot wahrscheinlich wirklich eine gewisse Attraktivität abgewinnen. Also wohl doch keine Ironie.
Ingeborg Seiffert war die Fachleiterin für Deutsch, und Hieronymus befand sich in trauter Runde von Fachkollegen in der heutigen Fachkonferenz. Er kannte Ingeborg seit etlichen Jahren, und wohl schon seit Jahrhunderten war sie die Fachleiterin Deutsch an der Peter-Ustinov-Schule. Noch nie hatte er sie anders gesehen als im Faltenrock mit Kniestrümpfen darunter und in derben Wanderschuhen. Heute war der Rock dezent blau, und oben trug sie einen Pullover mit dezentem blau-rotem Norwegermuster, das mit dem gleichfarbigen Muster ihrer üblichen Kniestrümpfe korrespondierte. Die Kurzhaarfrisur des dunklen, aber leicht angegrauten Haars war links gescheitelt wie immer. Ihr Ruf bei den Schülern lautete: streng, aber gerecht. Sicher macht ihr von denen keiner so leicht ein X für ein U vor (oder andersherum), dachte Hieronymus wehmütig.
Читать дальше