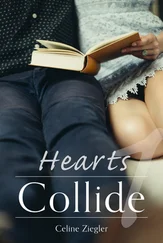„Es ist nicht weit von hier!“, schrie plötzlich der Deutsche, weil Pattons seine Waffe tiefer in enger an dessen Schläfe drückte. „Es ist – Immer in Richtung Norden! Er lebt mit seiner Familie an einer einsamen Kreuzung! E-Er sollte dort sein, a-aber ich weiß nicht, ob er das wirklich ist u-u-nd i-ich – Bitte erschießt mich nicht!“
Pattons grinste zufrieden und ich fragte mich, was er mit dieser Information anfangen wollte. Wir waren nicht auf der Suche nach einem deutschen Offizier, sondern nach der nächsten Stadt, um sie einzunehmen.
„Wieso sollte ich dich erschießen?“, säuselte Pattons zu dem Deutschen. „Du hast uns doch geholfen. Richtig?“
Der Deutsche nickte heftig. „B-Bitte.“
Doch etwas in Pattons Gesicht veränderte sich und mit einem Mal sah man Grausamkeit in seinen Augen. „Aber Gnade ist etwas für Schwächlinge.“ Und dann schoss er.
Der Schuss ließ uns zusammenzucken, obwohl jeder damit hätte rechnen sollen. Ich spürte, wie ein Blutspritzer auf meiner Wange landete, den ich wütend wegwischte, während ich Major Pattons misstrauisch beobachtete, wie er den toten Körper des Deutschen zurück in den Dreck fallen ließ.
Irgendetwas an Pattons gefiel mir nicht. Ich wusste zwar, er war ein egozentrisches Arschloch, aber da war noch etwas. Ich konnte es nicht definieren, das konnte ich lange Zeit nicht, aber dieses Etwas, das mich störte, schürte meinen Hass.
Eisige Stille breitete sich in der Runde aus, als alle auf die Leiche des Deutschen starrten. Normalerweise war es ein Fest so etwas zu sehen, doch dieses Mal war es anders.
Pattons schob seine Waffe in den Hosenbund und sah uns an. „Packt eure Sachen, wir brechen unverzüglich auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren.“
Ich runzelte die Stirn und fragte, während die Ersten schon gingen: „Wer ist Dorner?“
Überrascht von meiner Frage, fuhr Pattons Kopf zu mir herum. „Du schon wieder.“ Er zeigte auf die Leiche. „Bring ihn weg.“
Ich sah von der Leiche zu ihm. „Meine Frage war, wer Dorner ist und nicht, ob ich ihn wegbringen soll.“
Seine Augen verengten sich und ich wusste, er versuchte mir mit diesem Blick klarzumachen, dass er mehr Macht hatte, als ich, dennoch war meine Frage berechtigt. „Was geht es dich überhaupt an? Du tust, was ich sage und mehr nicht.“ Er drehte sich abrupt um und ging zum Hauptzelt.
Ich folgte ihm, weil ich mich mit solch einer Antwort, eher gar keiner Antwort, nicht zufriedengab. „Unser Ziel sollte das nächste Dorf sein und kein deutscher Offizier, mit dem Sie Probleme haben. Das ist Zeitverschwendung.“
„Die Pläne machst nicht du, sondern ich .“ Er riss das Tuch vor dem Zelt zur Seite und sah mich warnend an. „Und wenn du nicht willst, dass ich dich hier und jetzt genauso drangsaliere wie diesen verdammten Wichser dort hinten, dann halte dich besser daran. Und jetzt – entsorge die verfluchte Leiche.“
Ich sah ihm gereizt hinterher, als er im Zelt verschwand. Es war nichts Neues für mich, von
Leuten umhergeschubst zu werden und mit Arschlöchern zu kommunizieren, aber seitdem Major Pepper tot war, fühlte ich mich für die verbliebenen Männer aus unserem Trupp verantwortlich und ich wollte keinen von ihnen in den Tod schicken, nur weil Pattons irgendeinen undurchsichtigen Plan verfolgte.
Schon ein paar Schritte entfernt, ertönte noch einmal seine Stimme:
„Ey, Schwächling! Ich werde es dir ein letztes Mal sagen und halte dich besser daran: Für mich bist du genauso dumm wie der ganze Rest hier. Du bist ein streunender Hund, den man dressieren muss, nichts weiter. Gewöhn dich besser daran, nicht zu denken, sondern zu gehorchen, ansonsten endet das alles nicht gut für dich.“
Annemarie Dorner
„Anne!“, rief meine Mutter nach mir und ich erschrak, wodurch ich meinen Blick von dem dunklen Wald, den ich von unserer Terrasse sehen konnte, losriss. „Wir essen, komm‘ rein, du weißt, dass du nicht alleine rausgehen sollst!“
Ich seufzte schwer.
Schon viele Jahre lebte ich beschützt und sollte von der Welt da draußen und was um uns herum passierte, nichts mitbekommen. Mein Vater und meine Mutter legten viel Wert darauf, dass Katharina und ich eine glückliche Kindheit haben sollten, was bedeutete: Der Krieg existierte nicht in unserer Familie. Wir durften kein Wort darüber verlieren, in die Schule gingen wir natürlich schon lange nicht mehr und Kontakt zu anderen Menschen, außer unserer Familie war strikt verboten. Wir sollten nichts von all dem Leid mitbekommen, um nicht verdorben zu werden, hörte ich Vater und Mutter einmal laut im Flur diskutieren.
Was sie jedoch nicht ahnten, war, dass Katharina und ich durchaus wussten, was sie taten und was in der Welt passierte. Natürlich wussten wir es. Vater meinte immer, dass diese ‚Phase‘ in unserem Land nicht schlimm sei, es könnte passieren, dass wir von anderen Ländern angegriffen werden, alles war okay, nichts zu befürchten, Katharina und ich seien sicher.
Doch sie logen. Und ich wusste , dass sie logen, weil Vater einer dieser Menschen war, die diese ‚Phase‘ unterstützte. Er war schon immer ein hochrangiger General, hatte viel zu sagen und schon mehrere Male habe ich ihn und seine Kollegen bei Gesprächen belauscht. Sie sprachen über Juden, Adolf Hitler und Länder, denen Deutschland demnächst den Krieg erklären würde. Nun bin ich siebzehn Jahre alt und schon lange hatte ich begriffen, dass mein Vater für Mörder arbeitete, und Menschen aus ihren Häusern abholen ließ, um sie ihrem sicheren Tod zuzuführen. Ich war mir nie sicher, wie ich mich ihm gegenüber verhalten und ob ich ihn dafür verurteilen sollte, denn er beschützte unsere Familie und gab alles, damit wir glücklich waren. Und ich liebte ihn. Schließlich war er mein Vater.
„Ich komme!“, rief ich meiner Mutter zurück und stand von dem Stuhl auf, der in einer geschützten Ecke stand.
Ich war oft hier und sah in die Ferne, weil ich wusste, irgendwo dort draußen waren Menschen, die gerade um ihr Leben kämpften. Seien es Deutsche, Amerikaner, vielleicht Briten. Sie waren dort und sie starben. Aber was ich auch wusste war, dass ihnen nichts anderes übrigblieb, als uns Deutsche niederzuzwingen. Es war ein seltsames Gefühl mit der Tatsache zu leben, dass man in seinem eigenen Land dafür gehasst wurde, was man nun mal war.
Ich betrat unser großes Haus und der Kronleuchter in der Eingangshalle strahlte mir entgegen. Vater legte immer sehr viel Wert darauf, dass wir nobel lebten und es nichts gab, was uns fehlen könnte. Es gefiel mir nicht, doch Katharina, meine kleine Schwester, mochte es sehr. Ich fühlte mich in diesem riesigen Haus, viel zu klein und mickrig.
Katharina, Vater und Mutter saßen schon am gedeckten Tisch, als ich das Esszimmer betrat. Unser Essen wurde von Dienstmädchen serviert und ich setzte mich auf meinen Platz neben Katharina, die mich traurig anlächelte. Schon seit Ewigkeiten lächelten wir nicht mehr, weil wir glücklich waren, sondern einfach, um uns gegenseitig das Gefühl zu geben, dass wir nicht alleine waren. Es durften keine Freundinnen mehr zu uns kommen. Maria, das jüdische Mädchen, mit dem ich meine frühere Schulzeit verbrachte, war nicht mehr da. Vielleicht war sie, … aber diesen Gedanken verbat ich mir stets fertig zu denken.
„Anne, reichst du mir bitte die Bohnen?“, unterbrach mein Vater die Stille und ich nickte sofort und gab Katharina die Schüssel mit den Bohnen, damit sie diese an Vater weiterreichen konnte.
Die Stimmung am Tisch war tagtäglich angespannter. Seit Vater und Mutter wussten, dass Katharina und ich zu alt waren, um uns zu verstehen zu geben, dass das, was da draußen passierte, nicht schlimm war, gingen sie anders mit uns um. Sie wählten ihre Worte sehr genau aus, gingen all unseren Fragen bezüglich des Krieges aus dem Weg und sprachen oft über Belanglosigkeiten, wie das Wetter, das Obst an den Bäumen oder so etwas. Mein Vater war sowieso sehr selten Zuhause, weswegen wir nicht oft die Chance hatten mit ihm zu sprechen. Aber er war im Moment hier, warum, wusste ich nicht. Er wirkte sehr geknickt und Mutter auch. Katharina dachte, jemand aus unserer Familie sei krank und würde bald sterben, doch ich spürte, dass da mehr war. Etwas, das wir wieder einmal nicht wissen durften. Vielleicht etwas, das uns sagen sollte, dass er in nächster Zeit bei uns sein würde, weil er bald nie wieder bei uns sein würde. Das waren Dinge, die ich mir vorstellte, weil ich damit rechnen musste, dass er jeden Moment, in dem er nicht Zuhause war, sterben konnte. Oder umgebracht von unseren Feinden.
Читать дальше