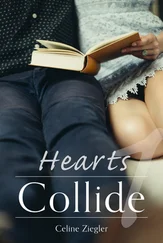„Ich auch“, sagte ich und musste lauter sprechen, weil ich das Gefühl hatte, die Musik wurde immer penetranter. „So habe ich es zumindest gelesen.“
James nickte und trank von seinem Bier. Er gehörte zu die Sorte Mensch, die hier und jetzt tranken, weil sie wussten, die Chance, wieder zurückzukommen, war gering. Er hasste den Krieg und er hasste es, nach Deutschland gehen zu müssen, aber er tat es aus Überzeugung. Er war ein guter Mann, der keiner Fliege was zu leide tun würde, er würde nur in allergrößter Bedrängnis einem Menschen ein Haar krümmen.
Meine Eltern haben die ganze Nacht geweint“, erzählte er mir. „Sie haben mich quasi auf Knien angebettelt nicht zu gehen. Und natürlich hat mich meine Verlobte angefleht zu bleiben.“ Nachdenklich schüttelte er den Kopf und starrte auf die Holztheke. „Mann, es ist definitiv der falsche Zeitpunkt für so etwas. Sie ist im vierten Monat schwanger.“
Ich legte aufmunternd meine Hand auf seine Schulter, um ihm mein Mitgefühl zu zeigen. Er konnte, genauso wenig wie ich, nichts an seiner Situation ändern. Wir waren nun mal Soldaten und es gab kein Zurück mehr. Man schrieb das Jahr 1941 und wir würden unsere Pflicht tun.
„Wie geht es deiner Mutter?“, fragte James mich, um von seiner misslichen Lage abzulenken. „Oder Lisbeth und George? Wie haben sie reagiert?“
Ich stützte mich mit den Ellenbogen gegen die Theke und drehte die Bierflasche in meiner Hand.
„Meine Mutter muss irgendwie damit fertig werden und die Kleinen … Ich weiß es nicht.“
„Du weißt es nicht? Du hast es ihnen nicht gesagt?“
„Ich konnte es nicht. Als Vater sich damals verabschiedete, wollte ich ihnen so ein Abschiedsgespräch kein zweites Mal antun.“
James nickte verständnisvoll und versuchte zu lächeln, auch wenn ich wusste, dass er unsere Lage um Mengen mehr hasste, als ich. „Wir müssen nur den Kopf oben halten, dann kommen wir hundertprozentig wieder nach Hause.“
Ich stimmte ihm zu, obwohl mir gar nicht wohl dabei war. In meinem Kopf hatte ich bereits mit meinem Leben in Amerika abgeschlossen und das sogar schon ziemlich lange. Ich wusste immer, wenn es irgendwann soweit kommen würde, wenn Amerika tatsächlich angegriffen würde und wir gegen Hitler kämpfen müssten, dann wird es kein nach Hause mehr geben. Tod oder Tod, ich war mir sicher. Natürlich sagte ich das James nicht, er war schon immer streng gläubig und betete für eine gesunde Heimkehr. Deswegen ließ ich ihm seine Hoffnung.
Doch auch mich erwischte es irgendwann, als wir mit unseren Schiffen in Richtung Frankreich reisten. Ich saß in meiner Kabine und starrte auf das einzige Bild, das ich mir erlaubt hatte, mitzunehmen, nachdem ich von Zuhause wegging. Es zeigte Lisbeth, George und meine Mutter. Auch wenn es nur schwarz-weiß war, meine Erinnerung füllte all die Farben aus. Ich würde sie schrecklich vermissen, verdammt, … wie sehr würde ich sie vermissen. Doch egal wie hart es klingen mochte, ich hatte eine Aufgabe vor mir. Mein Ziel war ab sofort Deutschland und der Kampf um Befreiung. Nur darauf durfte ich mich jetzt konzentrieren.
Deswegen packte ich das Foto weg, als Theo in die Kabine kam, um mich nach oben zu den anderen zu schleppen. Der Weg über den Atlantik war ewig lang, deswegen hatte man nur wenig Möglichkeiten die Zeit totzuschlagen. Aber Deutschland kam immer näher.
Es verging unendlich viel Zeit und es veränderte sich eine Menge. Wir wechselten oftmals das Platoon, unsere Soldaten starben, manche schafften es und starben dann kurze Zeit später. Mit der Zeit lernte man, dass Freundschaften das Schlimmste überhaupt sein konnten. Man musste immer damit rechnen, dass der Kamerad, mit dem man am Abend im Lager noch lachte, vielleicht schon morgen nicht mehr unter den Lebenden war. Anfangs viel es jedem schwer, man wollte trauern um den Freund, der fiel, durfte aber nicht. Irgendwann verlor man keine Freunde mehr, sondern einfach nur Männer, mit denen man im Kampf war.
Unser Major Pepper brachte den Jungs und mir bei, dass Trauern nicht erlaubt sei. Er hatte Recht. Er war erfahrener als wir alle. Er war ein Arschloch, doch er wusste, was er tat und er wusste, wie er mit uns umgehen musste. Bis er in einem Hinterhalt, durch einen Kopfschuss der deutschen Soldaten, starb. Wahrscheinlich würde ich nie den Moment vergessen, in dem ich spürte, dass sich hinter diesem verdammten Baum einer dieser Drecksnazis versteckte, doch da war es bereits zu spät. Das waren Vorkommnisse, die passierten nun mal, damit mussten wir umgehen. Hier blieb uns nie etwas anders übrig.
Wir zogen mit unserem Platoon, das aus nicht mehr als zwanzig Leuten bestand zum nächsten Stützpunkt und jeder hatte damit gerechnet, dass unser Weg hier endete. James betete jede Minute, Theo schwieg. Die Stimmung war am Tiefpunkt. Wir kamen vollkommen unterkühlt am Stützpunkt an. Unser Major war tot, unsere Vorräte leer. Die Tatsache, dass jeder von uns ein leichtes Ziel wäre, weil wir keine Munition mehr hatten, ließ uns nichts anderes übrig, als auf James Gebete zu hören und zu hoffen, dass uns keine deutschen Truppen entgegenkamen.
„Wir werden alle verrecken“, jammerte Theo, während wir durch den tiefen Matsch liefen, der einem das Laufen erschwerte. Seit Tagen stampfen wir durch diesen gottverdammten Matsch. „Ich gebe uns noch eine Nacht. Dann sind wir alle tot.“
Ich blickte zu ihm, wie er geknickt zu Boden sah, geradeaus und schlug ihm meine Hand auf die Brust, um sein Gejammer zu stoppen, weil mir sehr gutbekannte Geräusche hörte. Panzer und Stimmen, die Englisch sprachen. „Theo. Sieh geradeaus.“
Er hob sofort seinen Kopf und griff reflexartig nach seiner Pistole, doch ich hielt seinen Arm fest. Wir beide hatten letzte Nacht Wache, weswegen wir beide ziemlich fertig waren. Alle, die mit uns liefen, waren genau wie wir, einfach nur totmüde.
„Wir sind da“, ertönte James Stimme hinter uns und Theo sah mit müden Augen zu ihm nach hinten, dann wieder nach vorne. „Amerikaner.“
Ich klopfte ihm auf die Schulter und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, wie erleichtert auch ich war, endlich am Etappenziel anzukommen. Theo litt am meisten unter dem Tod des Majors, deswegen brauchte er unseren Beistand. Seine Augen waren stets glasig und er wischte sich heimlich immer einmal schnell durchs Gesicht, doch er erlaubte es sich nicht zu weinen. Gut möglich, dass es die Müdigkeit war, aber naja, wir waren alle während unserer Wanderung, ein bisschen sentimental geworden.
„Wir sind da, Theo“, wiederholte ich und legte meine Hand auf seinen Hinterkopf, an dem noch ein wenig von seinem Blut klebte.
Meine Fußsohlen brannten, der Rücken tat höllisch weh und ich konnte die Augen nur noch mit einiger Willensanstrengung offenhalten. Aber keiner von uns durfte sich seinen Empfindlichkeiten hingeben, sonst würden wir niemals ankommen. Nach mehreren Tagen Fußweg durch Flüsse und morastige Wälder, waren wir endlich angekommen, wo wir sicher waren. Wir würden etwas zu essen und zu trinken bekommen, einen halbwegs ordentlichen Schlafplatz und Ruhe.
Theo sah nach vorne und nickte mehrmals, während er schluckte und die Erkenntnis, dass wir nun tatsächlich da waren, ihn traf. Er wischte sich mit dem Ärmel seiner braunen Jacke die Tränen von den Augen und ich ließ meinen Arm sinken.
Wir liefen über die große Wiese zu den Zelten und schon von weiten sah ich, wie uns einer der Soldaten, die Wache hielten, entdeckte und weitere alarmierte. Sofort kamen mehrere Hilfskräfte auf uns zu.
„Platoon vier, richtig?“, fragte einer von ihnen und übergab mir eine Thermoskanne mit Wasser.
Ich nickte und reichte das Wasser an Theo weiter, der es er gierig nahm, sich auf einen Holzstuhl fallen ließ, die Flasche ansetzte, und trank. „Richtig“, sagte ich zu dem Helfer und sah mich um. „Wieso sind hier so wenige Soldaten? Die Rede war von mindestens zweihundert.“
Читать дальше