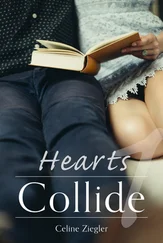Theo und ich lachten leise und James verschränkte, absolut nicht amüsiert, die Arme und ging zu weiteren Männern, die Hilfe brauchten. Er murmelte „Verdammte Besserwisser“ vor sich hin und verschwand.
„Ich habe letzte Nacht einen Brief geschrieben“, sagte Theo, als James nicht mehr zu sehen war und zog einen Zettel aus seiner Brusttasche.
Ich warf einen Blick darauf und zog mir meine braune Jacke an, richtete den Kragen. „Wieso?“
Er sah nachdenklich auf den Brief und reichte ihn mir schließlich. „Ich will, dass du ihn meinen Eltern gibst, wenn du wieder in Amerika bist.“
Meine Augenbrauen schoben sich zusammen und ich sah von dem Brief, den er mir entgegenhielt zu ihm. „Ist das dein Ernst? Ein Abschiedsbrief?“
„Ja, ich weiß, wie du darüber denkst, aber tu es einfach, für mich.“ Er faltete den Bogen klein zusammen und schob ihn mir Brief in die Brusttasche meiner Jacke. „Ich habe ziemlich viel nachgedacht, seitdem Pepper tot ist und deswegen habe ich ihn geschrieben. Außerdem wirst du diesen Dreck hier überleben, da bin ich ganz sicher, und deshalb gebe ich ihn dir.“
Ich band mir meine Schuhe fester zu und konnte nicht glauben, was er da von sich gab. Theo drehte immer mehr am Rad. „Gott, du bist so unerträglich sentimental geworden.“
Unsere Aufmerksamkeit wurde von Gelächter gefangen genommen und wir sahen nach rechts in den Hof des Hauses, in dem das Mädchen, Annemarie, so hieß sie, gerade die Hände vor dem Oberkörper zusammengebunden bekam. Man machte sich über sie lustig, während ihre kleine Schwester unglücklich danebenstand und bereits ein Seil um die Hüfte gebunden hatte, was von Walt gehalten wurde. Es war ein so jämmerlicher Ausblick.
„Jetzt werden sie schon behandelt wie Tiere“, brummte Theo neben mir. „Oder wie Sklaven. Das ist gegen jede Soldatenehre.“
Ich machte die Schnallen an dem Rucksack zu und sah rüber zu Annemarie. Diese stand mit müden Augen, gebundenen Händen mitten im Hof und es blieb ihr nichts anderes übrig, als zu warten.
„Gewöhn dich dran. Erinnerst du dich noch an Emma?“
Er nickte und verzog sein Gesicht. „Natürlich. Wie könnte ich das vergessen?“
Emma war ein deutsches Mädchen von vielleicht neunzehn Jahren, das es genau zwei Tage bei uns ausgehalten hatte. Sie war nicht aus Zweckgründen, bei uns, sondern einfach, weil jemand sie aufgegabelt hatte und seinen Spaß wollte. Mindestens fünf Kerle von uns hatten sie misshandelt, bis sie starb. Und dass sich dieses Rudel weibstoller Männer, die nur ganz selten ihren natürlichen Trieb befriedigen konnten, nicht an Annemarie oder gar an der kleinen Schwester vergreifen würden, war auszuschließen.
„Komm, es geht los“, unterbrach ich Theos sorgenvollen Blick zu unseren Gefangenen und erhob mich. „Bereit ein paar Deutsche zu tyrannisieren?“
Er seufzte und stand ebenfalls auf. „Vierundzwanzig Stunden am Tag.“
Annemarie Dorner
Wir liefen bereits zwei Stunden durch die Wälder und Felder und ich war mir nicht sicher, wohin uns dieser Weg führte.
Meine Füße schmerzten höllisch, meine Handgelenke waren bereits aufgescheuert, weil der Strick darum an meiner Haut rieb. Ich hatte Durst, traute mich aber nicht, nach etwas zu trinken zu fragen. Ungefähr eine Stunde nach dem Aufbruch, kam was kommen musste. Major Pattons wollte schließlich wissen, wo genau mein Vater sich versteckte. Mir kam nur Halle in den Sinn. Dort haben wir Vater manchmal besucht. Also hoffte ich ihn dort wiederzufinden. Ich gab mich der Hoffnung hin, dass er uns von diesen Menschenschindern befreien und diese Unmenschen zur Hölle jagen würde.
Viele Informationen über den möglichen Aufenthaltsort unseres Vaters hatte ich allerdings nicht. Er hat ja zu Hause nicht viel erzählt, nur das was ich durch lauschen erfahren habe, konnte mir jetzt vielleicht nützlich sein. Diese ganze Sache war riskant und ich musste schlau sein, um Pattons dazu zu bringen, uns nicht schon vor Halle tot in einen Graben zu werfen.
Ich starrte auf den die harte Erde unter meinen Füßen und hoffte, dass wir bald eine Pause machen würden. Katharina litt auch, sie wurde immer mal mit dem Seil, das um ihre Hüfte gebunden war, ruckartig nach vorne gezogen, weil sie zu langsam war. Sie dachten gar nicht daran, dass sie doch erst ein zwölfjähriges Mädchen war. Jeder von denen war es gewohnt, über weite Strecken zu laufen.
„Anne“, sagte sie leise zu mir und ich merkte sofort, wie der Mann, der sie am Seil hielt, anstarrte. „Ich habe Durst.“
Ich seufzte. „Ich weiß, …“
„Was hat sie gesagt?“, fragte der Mann mich unfreundlich, weil er kein Deutsch verstand.
„Sie ist durstig“, antwortete ich ihm und hoffte, dass er uns einfach etwas zu trinken geben würde. „Wir sind beide durstig.“
„Sag ihr, sie soll ihren Speichel trinken und warten, bis wir Rast machen.“ Er zog an dem Seil von Katharina, worauf sie wimmerte. „Wir sind doch keine verdammte Bar.“
Weil Katharina ihn nicht verstand, sah sie mich an und in ihren traurigen Augen konnte ich lesen, wie sehr sie etwas zu trinken benötigte. Es schmerzte mich, sie so zu sehen, vor allem weil ich so entsetzlich hilflos war.
„Mein Gott“, sprach eine Stimme hinter uns und ein Mann, ich glaubte mich zu erinnern, dass er James hieß, lief neben mich und öffnete seine blecherne Trinkflasche. „Gib ihnen etwas zu trinken, wenn sie durstig sind, ihr quält sie schon genug.“
Sprachlos sah ich auf die Flasche, die er mir freundlich entgegenhielt. Es war seltsam, dass einer von ihnen so nett zu uns war, während wir von einigen anderen schon zu oft rumgeschubst worden waren.
„Nun trink schon“, sagte er mit warmer Stimme und drückte mir die Flasche in die Hand, sodass ich sie gerade so halten konnte. „Wir haben genug für dich und deine Schwester.“
Mit leiser Stimme bedankte ich mich, nahm die Flasche mit den zusammengebundenen Händen entgegen und übergab sie zuerst Katharina die Flasche, damit sie trinken konnte. Dieser Mann hatte nette Augen und wirkte nicht so verbittert, wie viele von den Kerlen. Natürlich hatten alle diesen gewissen Ausdruck im Gesicht, der signalisierte, was sie alles durchmachten, aber er war nett. Er war einfach nett.
„Bald machen wir eine Pause“, erklärte er uns, während Katharina gierig das Wasser trank. Auf seinem Helm erkannte ich ein rotes Kreuz auf weißen Untergrund, was auf einen Sanitäter hinwies. Vielleicht war er deswegen so fürsorglich. „Es dauert nicht mehr lange und dann könnt ihr euch ausruhen.“
Ich nickte schüchtern lächelnd, um ihm für das Wasser zu danken. Doch er sah starr nach vorne und sein Lächeln gefror.
Der Feldweg, auf dem wir liefen, endete und wir standen plötzlich auf einer großen Wiese. Und erst als ich fast ausrutschte und mich gerade noch so fangen konnte, wandte ich den Blick von Katharina, und der Wasserflasche ab, dem Untergrund, auf dem wir standen, zu.
Ich stand mit meinem Fuß in den Fäkalien einer Leiche.
„Oh Gott“, keuchte ich entsetzt und hob den Kopf.
Was ich als nächstes erblickte, war das Grauenvollste, das ich bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben sah. Mehrere halbverweste Leichen. Die Wiese war matschig, die Körper der Menschen lagen schon länger dort. Es musste ein Kampf stattgefunden haben, und diese armen Seelen, waren die Verlierer. Der Geruch, den ein teils verbrannter Kübelwagen ausströmte, mischte sich mit dem Geruch nach Blut, und Tod. Mir wurde kotzübel von dem Anblick und dem Gestank, der über diesem Ort lag. So roch Tod und Verderben. Hass und Krieg. So roch es also.
„Weiterlaufen“, meckerte ein Mann hinter mir und ich wurde nach vorne geschubst, weil ich vor Schreck meine Schritte abgebremst hatte.
Читать дальше