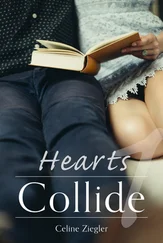1 ...8 9 10 12 13 14 ...33 „Bei uns zu bleiben. Es war ein ziemlicher Fehler.“
Sie atmete tiefer ein und aus, umfasste ihre Beine und machte sich kleiner. „Ich weiß, …
Leutnant.“
Ich sah sie an. „Was? Wie hast du mich genannt?“
„Ä-Äh, ich dachte …“ Sie ging meinem Blick aus dem Weg. „Major Pattons meinte, ich solle jeden mit dem Dienstgrad ansprechen. Als Zeichen des …“
„Als Zeichen des Respekts“, vollendete ich ungläubig ihren Satz und lachte bitter, sah wieder in die Ferne. Das Reh hatte sich schon in der Dunkelheit des Waldes in Sicherheit gebracht. „Gott.“ Ich spürte, dass all das nicht gut ausgehen würde. Für ihn und für mich nicht.
„Ja“, hauchte das Mädchen leise und strich unsicher mit ihrem Finger über den Saum ihres schmutzigen, hellbraunen Kleides. „Aber … Ich … Du kannst Annemarie zu mir sagen.“
Ich konnte noch keinen Sinn hinter diesem Gespräch ausmachen, deswegen sagte ich nichts darauf, sondern stützte meine Ellen auf die Knie. Hier zu sitzen und mit ihr zu sprechen, war genauso sinnlos, wie der Fakt, dass sie und ihre kleine Schwester nun einen Teil unseres Zuges darstellen sollten. Sie würden keine vierundzwanzig Stunden mit uns überleben.
Als sie wieder zu zittern begann und ihr Kinn auf ihre Knie legte, betrachtete ich sie. Sie war nicht sonderlich alt, war aber auch kein Kind mehr. Ich schätzte sie auf siebzehn, vielleicht auch schon achtzehn, auch wenn ihr langes blondes Haar sie jünger wirken ließen. Eine typische Deutsche, so würde man sie in unseren Worten beschreiben, doch diesmal tat ich es nicht. Irgendetwas an ihr war anders.
Ich sah hinter uns zum Haus und ging sicher, dass niemand wach war und uns nun auch niemand hören konnte. Alles war still, ich hörte keine Schritte, keine Stimmen, Licht brannte auch nicht. Deswegen drehte ich mich wieder nach vorne und sagte: „Du kannst gehen.“
Ich sah mich zum Haus um. Pattons hatte ein paar von den Jungs als Nachtwache abgestellt. Natürlich hatten ihre Kameraden ihnen auch von den Getränken etwas nach draußen gereicht, damit sie nicht zu kurz kamen. Die Wachen liefen durch die helle Nacht, deutlich erkennbar, um die Hausecke in den dahinter liegenden Garten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir von ihnen nicht zu sehen, also sagte ich leise zu Annemarie: „Du kannst gehen.“
Erst war sie still, dann hob sie verwundert ihren Kopf. „Wie bitte?“, fragte sie mit leiser Stimme nach.
Ich orientierte mich schnell in der Umgebung und suchte den besten Weg, um möglichst unauffällig von hier verschwinden zu können. „Geh links herum um das Haus und dann verschwinde. Ich werde wegsehen.“
Nun sah sie mich direkt an und ich sah sie an. Ihre Augen waren, trotzdem das Mondlicht die einzige Lichtquelle war, unmenschlich hell, ich hatte noch nie so tiefblaue selten solche blauen Augen gesehen. „Du lässt mich einfach … gehen?“
„Ich gebe dir eine Chance, ja. Pattons ist ein Idiot, wenn er ausschließt, dass du abhaust, obwohl er dich alleine hier draußen lässt. Aber tu es schnell.“
Sie schwieg für ein paar Momente, in denen ich ihren Blick auf meinem Profil spürte, dann sah sie ebenfalls nach vorne, spielte mit ihren schlanken Fingern. „Nein.“
Eigentlich überraschte mich ihre Antwort nicht. „Nein?“, fragte ich trotzdem und wandte mich ihr wieder zu.
Langsam schüttelte sie den Kopf. „Ich lasse Katharina nicht allein. Lieber erfriere ich hier draußen.“
Ich schaute von ihrem Gesicht zu ihren Händen, dann wieder zu ihrem Gesicht. Gut möglich, dass ich genau das Gleiche entschieden hätte, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre. Wenn ich an Lisbeth und George dachte und mir vorstellte, sie wären in diesem Haus gefangen und ich säße hier draußen und hätte die Chance zu flüchten, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tun würde sehr gering.
Deswegen vermutete ich: „Anscheinend weiß Pattons das.“
Sie nickte wortlos.
„Dennoch. Ich gebe dir keine zweite Chance“, bot ich es ihr das letzte Mal an und stand auf. „Und ich kann dir nicht versichern, dass du es nicht bereuen wirst.“
Als Antwort umklammerte sie nur ihre Beine und legte ihren Kopf auf ihre Knie. Sie würde nicht gehen, das stand fest. Ich wusste nicht, was Pattons und die anderen Männer mit ihr und ihrer kleinen Schwester bereits angestellt hatten und ganz bestimmt würden sie auch in Zukunft nicht zimperlich mit ihnen umgehen. Aber mir war das zu diesem Zeitpunkt einfach egal.
Deswegen öffnete ich die Haustür und sah von dem Blutstreifen, der vom Flur über die Veranda, die Treppen herunter, zu ihr, die direkt daneben saß. Ich nahm an, dass es das Blut ihrer Mutter war, dessen Leiche nach draußen geschliffen wurde. Scheiße, dieses Mädchen musste hier draußen verdammt leiden.
„Annemarie“, nannte ich sie das erste Mal beim Namen. Sie wandte sich nicht zu mir, aber ich bemerkte ihre Aufmerksamkeit. „Die Kissen auf dem Stuhl.“
Sie hob wieder etwas ihren Kopf und sah nach rechts zu dem Stuhl, der dort stand. „Was?“
Ich trat durch den Türrahmen. „Wahrscheinlich wird es für lange Zeit die letzte Nacht sein, in der du Schlaf bekommen kannst. Niemand wird dir morgen die Chance geben, dich auszuruhen.“ Und dann lief ich durch den Flur zurück in das Zimmer, das ich mir als Quartier für diese Nacht ausgewählt hatte. Ich hörte durch das gekippte Fenster ihre leisen Schritte und wie sie die Kissen von dem Stuhl nahm.
*
Ich lud meine Thomson mit Munition, um mich für den heutigen Tag vorzubereiten. Die Nacht war sehr kurz, ich schätzte, wir hatten vielleicht sechs Uhr früh am Morgen. Es war noch dunkel, aber die ersten Amseln machten durch lautes Singen schon auf sich aufmerksam. Die Männer hatten in der vergangenen Nacht die Alkoholvorräte im Keller des Hauses entdeckt und dem Wein, Likör und Schnaps ziemlich gut zugesprochen. Man sah den meisten den dicken Kopf an, den sie sicher auch spürten. Der Krieg machte das. Väter, die nie Alkohol anrührten, versuchten damit das Gehirn zu vernebeln. Sie hofften, die Brutalität und Unmenschlichkeit, wie natürlich auch die Verletzten und Toten irgendwie ertragen zu können, ohne wahnsinnig zu werden.
„Es wird nicht verheilen, wenn du es jedes Mal wieder aufkratzt“, mahnte James Theo, dessen Wunde am Hinterkopf er untersuchte. Diese hatte, die er sich während unseres letzten Hinterhalts zugezogen hatte. „Versuch weniger Mützen zu tragen, damit Luft darankommt, das habe ich dir schon etliche Male gesagt.“
„Man, du sagst mir ständig irgendwelche Sachen“, murrte Theo. „Kleb es doch einfach zu und dann hat sich das erledigt.“
Ich saß neben den beiden auf der Treppe und sortierte die Sachen in meinem Rucksack.
„Damit ist es nicht getan und das weißt du. Jonathan!“
Ich brummte auf, als ich mir das Taschenmesser, das mir mein Vater einmal zum Geburtstag schenkte, wegsteckte. „Es wird ihn nicht umbringen. Der Kopf ist ja noch dran.“
„Hast du deine Verletzung gestern Abend noch behandelt?“, ging James nicht auf meine Aussage ein.
„Ja.“
„Hast du nicht.“ James legte seine Utensilien weg und rief mir noch zu, während er die Treppe runter hinter Theo, herlief. „Ich will nicht, dass du an einer Blutvergiftung stirbst, nur weil du dich nicht darum kümmerst. Normalerweise sollte ich es nähen, das weißt du.“
Ich verdrehte die Augen, konzentrierte mich aber weiter auf meine Arbeit. „Ich hatte schon schlimmere Verletzungen und nie bin ich dran gestorben. Habe ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass ich alles überlebe?“
James schüttelte ungläubig den Kopf. „Das ist nicht lustig. Ein Messerstich ist nicht lustig. Lass mich wenigstens nachsehen.“
„Du führst dich wieder auf wie seine Mutter“, spottete Theo und lehnt sich feixend zurück um, uns zuzusehen. „Komm mal runter, wer weiß, ob er den heutigen Tag überhaupt überleben wird und dann juckt ihn diese blöde Wunde sowieso nicht mehr.“
Читать дальше