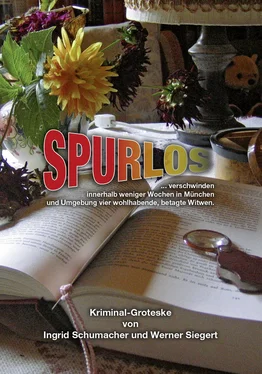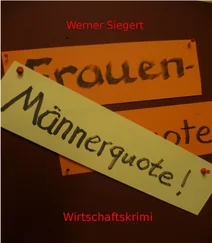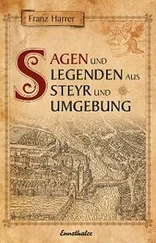Schließlich entschloss er sich, zu der früheren Adresse zu fahren und sich bei den Nachbarn zu erkundigen. Die Kühlmannstraße ist eine kleine Seitengasse in Laim, eine Münchner Stadtviertel. Von der Nummer 7 war nichts zu sehen außer einer zwei Meter hohen Thujenhecke, hinter der das Haus verborgen lag.
Am Gartentor war ein grüner Briefkasten befestigt, so groß wie ein kleiner Schrank und mit einem Nummernschloss gesichert wie ein Tresor. Eine Möglichkeit zu läuten gab es nicht. Nur eine kleine Messingplatte wies auf den fast unleserlich gewordenen Namen hin: Falke.
Heinz Baumann ließ sich nicht so leicht entmutigen. Er ging zurück zu seinem Auto und kam mit einer langen Rohrzange wieder, mit Hilfe derer er den Inhalt des Briefkastens vorsichtig herausziehen konnte: Keine Zeitungen, aber viel Reklame und etliche Briefe, darunter seine Einladung, die er vor vier Wochen abgeschickt hatte. Vorher hatte er sich sorgsam umgesehen, dass es keine Zeugen für seine Indiskretion geben würde.
Sorgfältig stopfte er alles wieder in den Kasten und machte sich auf den Weg zum Nachbarhaus. Überall hohe Hecken, aber immerhin Namensschilder und Klingeln. Im ersten Haus öffnete niemand. Beim zweiten erschien eine Frau am Fenster, das sie aber sofort wieder schloss. Dann hatte er Glück. Eine junge Frau verließ gerade das Haus. Er fragte sie ohne lange Einleitung:
„Wissen Sie, ob Frau Falke noch hier wohnt?“
„Keine Ahnung.“ Damit ging sie ungerührt ihrer Wege.
Aus dem nächsten Tor kam eine alte Frau, die offenbar neugierig mitgehört hatte.
„Die Falke? Die macht sowieso nicht auf.“
Wie sollte sie auch, dachte Baumann, wenn es keine Klingel gibt, mit der man sich bemerkbar machen könnte.
„Ist was mit ihr?“ mischte sich nun eine dritte ein.
Niemand hatte seit längerer Zeit Frau Falke gesehen oder gehört. Niemand hatte in letzter Zeit Kontakt zu ihr gehabt.
„Sie war immer schon sehr eigenartig.“
Als Baumann sich wieder dem Haus Nr. 7 zuwandte, liefen immerhin fünf Frauen voller Neugier und Erwartung hinter ihm her.
Baumann riss mit seiner Zange ein Loch in die Hecke, wo sie bereits etwas schütter war, und schlüpfte hindurch in einen Garten, der sicher einmal sehr schön gewesen war, wie gemacht für Sommerfeste und Grillpartys. An der Rückseite des Hauses entdeckte er ein Fenster, das nur angekippt war. Es ließ sich mit einiger Mühe von außen öffnen. Baumann stieg ein.
Inzwischen hatten auch die Frauen das Loch in der Hecke genutzt und schauten durch die Fenster. Ihre seit langem ungestillte Neugier zeichnete ihre Gesichter.
Der untere Raum des Hauses, von dem eine enge Treppe nach oben führte, sah aus wie ein Konzertsaal. Ein riesiger Flügel nahm die Mitte ein. Stühle waren in Reihen angeordnet. Notenhefte und verdorrte Blumensträuße lagen auf kleinen Tischen. Drei Fotos standen auf dem Flügel. Das eine zeigte Frau Falke als junge Frau mit einem Mann in Uniform. Sie hielten sich umschlungen und sahen einander an. Auf dem nächsten stand sie wiederum neben einem jungen Mann: Da war sie jedoch schon wesentlich älter. Dann erblickte Baumann das Foto vom letzten Klassentreffen.
„Hatte Frau Falke einen Sohn?“ fragte er die vor dem Fenster stehenden Frauen. Sie sahen sich an. Wer war dieser Mann und wieso wollte er das wissen.
„Kann sein.“ sagte die Älteste. „Eine Zeitlang hat ein junger Mann bei ihr gewohnt. Könnte ihr Sohn gewesen sein. Hajo hieß er.“
Baumann stieg nach oben. Seltsamerweise war dort die Küche. Der Stecker des Kühlschranks war rausgezogen. Er nahm ein Taschentuch und öffnete die Tür. Verdorbene, verschimmelte Lebensmittel und eine Anzahl von Tupper-Dosen füllten die Fächer.
Das Schlafzimmer schien unberührt. Alle Schränke waren gefüllt mit Kleidern, die der Mode von vor 30 oder 40 Jahren entsprachen.
Baumann verließ die Wohnung durch die unverschlossene Haustür.
„Und?“ fragte ein Chor von fünf aufgeregten Frauenstimmen.
„Ich werde die Polizei verständigen!“ kündigte Baumann an.
„Liegt sie da oben?“ „Ist sie tot?“
Er sah die Enttäuschung in den Augen der Frauen, als er kurz und knapp zur Antwort gab: „Nein!“
Dann nahm er sein Handy aus der Tasche und wählte die entsprechende Nummer.
Innerhalb eines halben Jahres drei spurlos verschwundene alte Frauen, Witwen, vermögende Witwen. Verzweifelte Suchanzeigen bei der Polizei. Nie hatte es so etwas gegeben. Einzelfälle - ja. Tötungsdelikte - ja. Aber da hatte man wenigstens eine Leiche. Man konnte die Fälle einordnen und der Mordkommission zuweisen. Man konnte am Fundort wertvolle Informationen sammeln und bei den Toten den ungefähren Zeitpunkt ihres Hinscheidens ermitteln. Es gab Blut- und Fußspuren, Reifenabdrücke, eventuell Zigarettenkippen, einen abgerissenen Knopf, ausgerissene Haare, Hautreste unter Fingernägeln. Jedenfalls etwas für eine DNS-Analyse.
Die speziell eingerichtete „Soko Witwen“ aber tappte im Dunkeln. Im Fall der Hermine-Adele Hudefarth konnte man auch bei der zweiten, äußerst akribischen Untersuchung des Hauses, des Geräteschuppens und des Gartens keinerlei Spuren gewinnen. Bis auf den Puder von Latexhandschuhen am Knauf der Haustür und der Gartentür. Immerhin hatte die alte Dame einige Tage zuvor 50.000 Euro von ihrem Festgeldkonto abgehoben. Sie war persönlich bei der Bank und hatte - wie immer korrekt - ihren Finanzbedarf Tage vorher angemeldet. Dieses Geld war nicht auffindbar, auch nicht in irgendwelchen Matratzen, Schrank- oder Schubfächern. Die Geldscheine zwischen der Seidenwäsche, 20.000 Euro, die „Eiserne Reserve“, wie sich die Dame auszudrücken pflegte, waren peu-à-peu zwischen Höschen, Hemdchen und Spitzen-Nachtwäsche hinausgeschmuggelt worden. Geld stinkt nicht! Aber da war sich Else-Marie nicht gar so sicher. Für den Fall, dass die Kripo doch mal alle Fächer ausräumt und vielleicht einen Spürhund nachschnuppern ließ, hatte sie reichlich Campher-Mottenkugeln ausgestreut.
Der Spürhund „Oskar“ kam auch, nahm an einem von Hermines Schals Witterung auf, schnüffelte sich durch Haus und Hof, um schließlich wie der Suchhund von Windows die Beamten und Anwärter verlegen und schwanzwedelnd von unten anzublinzeln. Hermine hatte sich in Luft und Campherschwaden aufgelöst.
Der Fall der frommen Maria Solemnis Hüttner - „heißt nicht auch eine Freundin von Beethoven so?“ mutmaßte ein Polizeischüler, „Solemnis habe ich schon mal gehört!“ - war ebenso verzwickt. Der Hinweis auf Beethoven half jedenfalls überhaupt nicht weiter. Immerhin war ihr Verschwinden ziemlich zeitgleich, also nur mit einem oder zwei Tagen Verzögerung, bemerkt worden. Und: Maria Solemnis hatte sich auf eine längere Abwesenheit eingerichtet. Sie hatte ebenfalls eine für die Lebenshilfegruppe unvorstellbare Summe von 70.000 Euro von ihrem Konto abgehoben.
Wieviele voyeristische Instinkte wurden bei den Beamtinnen und Beamten befriedigt, wenn sie geradezu verpflichtet waren, nicht nur in alle Schränke, Kommoden und Nachttische, sondern auch in alle Schächtelchen und Döschen hineinzuschnuppern? Ja sogar die Briefsachen, die Schuhschachteln mit Fotos, die Fotoalben, die Bücher, natürlich auch die Leitz-Ordner wurden liebevoll und neugierig gefilzt.
Hier gab es jede Menge Fingerabdrücke, nämlich die von Maria selbst, von Klara, von Anna Weidner und ihrem Mann Emil, Nutellaspuren von Alma. Maria Solemnis pflegte, wie man so sagt, ein offenes Haus. Die Fülle der Fingerabdrücke und DNS-Spuren erwies sich als ebenso wenig aussagekräftig, als hätte man gar keine gefunden.
Gab es Familienangehörige? Bislang hatte man vergeblich versucht, mit der Tochter Judith Verbindung aufzunehmen. An der Adresse, die man auf einem verblichenen Briefumschlag gefunden hatte sowie in Marias Geburtstagsverzeichnis, war sie jedenfalls nicht mehr erreichbar.
Читать дальше