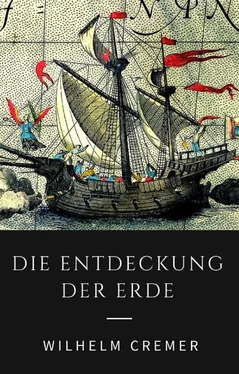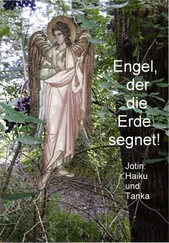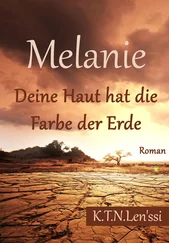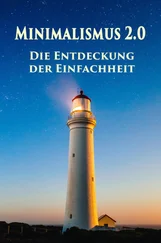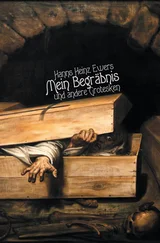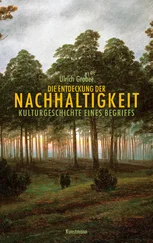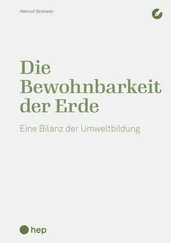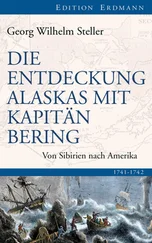Wir folgten seinen Küsten und trafen eine grosse Insel, die einen salzigen See enthielt. Hier landeten wir, sahen aber bei Tage nichts als Wälder. Bei Nacht jedoch bemerkten wir das Leuchten unzähliger Feuer und hörten ein mit schrecklichem Geschrei vermischtes Getöse von Pauken, Zimbeln und Flöten. Wir entsetzten uns darüber, und unsere Wahrsager befahlen uns, eiligst diese Insel zu verlassen. Wir segelten hierauf an einer glühenden, aber nach Wohlgerüchen duftenden Küste entlang, von der überall Feuerströme in das Meer stürzten. Der Boden war so heiss, dass man nicht darüber gehen konnte. Wir verliessen daher schnell diese Gegend, und die folgenden vier Tage, während wir auf offener See waren, schien uns das Land jede Nacht mit Flammen bedeckt zu sein. Mitten unter diesen Feuern aber war eins, das die anderen weit überragte und bis an die Sterne zu reichen schien. Doch sahen wir am Tage nichts als einen sehr hohen Berg, den man den Wagen der Götter nannte. Drei Tage lang fuhren wir an diesen Feuerströmen vorbei und kamen dann in einen Meerbusen, der das Südhorn hiess. In diesem Busen lag wieder eine Insel mit einem See und in dem See eine zweite Insel, die von wilden Menschen bewohnt war. Es gab im ganzen weit mehr Weiber darauf als Männer. Sie waren über und über mit Haaren bewachsen, und unsere Dolmetscher nannten sie Gorillas. Von den Männern konnten wir trotz unserer Bemühungen keinen einzigen ergreifen; sie entflohen über Schluchten hinweg und verteidigten sich mit Steinwürfen. Indes fingen wir drei Weiber, aber da sie ihre Bande zerrissen und uns mit ihren Zähnen angriffen und zerfleischten, töteten wir sie und zogen ihnen die Haut ab, die wir mit nach Karthago brachten. Mangel an Nahrung hinderte uns, weiter zu reisen, und wir kehrten zurück.«
Dieser Bericht hat schon die alten Griechen sehr interessiert. Der Fluss mit den Krokodilen und Nilpferden war wahrscheinlich der Senegal, der Götterwagen mit seinem nächtlich lodernden Feuer der Vulkan von Teneriffa. Auch hat der Gorilla, der grosse afrikanische Menschenaffe, nach diesem Bericht seinen Namen erhalten.
Ueber die Fahrt des Admirals Himilko nach dem Norden haben wir nur eine sehr späte, poetisch ausgeschmückte Beschreibung des römischen Dichters Avienus aus dem 4. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Die Karthager verstanden es nämlich, wie schon ihre Vorfahren, die Phöniker, ihre Handelsverbindungen in Dunkel einzuhüllen. Besonders suchten sie fremde Nationen davon abzuschrecken, sich durch die Säulen des Herkules hindurchzuwagen, indem sie allerlei Fabelgeschichten über die Schrecken des Atlantischen Ozeans verbreiteten. Jedenfalls erhielten sich diese Märchen noch bis in die Zeit der Römer.
Wie seltsam übrigens die Vorstellung selbst der griechischen Gelehrten über die Gestalt der Erde gewesen ist, ergibt sich aus folgender Zusammenstellung. Homer (und auch noch Herodot) betrachtete die Erde als eine runde Scheibe, Anaximander als eine Walze, Leukippus als eine Trommel und Heraklit als einen Kahn. Eudoxus hielt die Erde für ein längliches Viereck, Xenophanes für einen hohen Berg, Anaximenes für einen Tisch und Pythagoras für einen Würfel. Erst Aristoteles, der Lehrer Alexanders des Grossen, schloss aus dem runden Schatten, den die Erde bei einer Mondfinsternis wirft, und auch aus anderen Gründen auf die Kugelgestalt unseres Planeten. Archimedes war der erste, der diese auch schon den ägyptischen Priestern bekannte Kugelgestalt in sein Lehrsystem aufnahm, und Aristarch behauptete schon fast 300 Jahre v. Chr. die Umdrehung der Erde um die Sonne. Doch hielt sich daneben immer noch die Ansicht, dass die Erde eine runde Scheibe sei; die christliche Kirche verdammte dann später die Lehre von den Gegenfüsslern, und Kolumbus hatte lange Zeit schwer gegen diese Ansicht zu kämpfen, bis schliesslich die erste Weltumseglung durch Magalhaes allen Zweifeln an der Kugelgestalt der Erde ein Ende machte.
Für die Griechen, und überhaupt für die wissenschaftliche Forschung, begann mit den Eroberungszügen Alexanders eine neue Zeit. Der Sohn des makedonischen Königs Philipp fühlte schon in früher Jugend den Beruf in sich, ein Welteroberer zu werden. Als er von dem Philosophen Klearchos hörte, es gäbe noch unendlich viele Welten und auch der Mond sei von Menschen bewohnt, da weinte er, weil er diese Welten doch nicht alle erobern konnte. Vor allem wirkten auf ihn die Schriften des griechischen Arztes Ktesias, der siebzehn Jahre lang Leibarzt am Hofe des Perserkönigs Artaxerxes gewesen ist und sehr viel über asiatische Völker, besonders über die Inder, geschrieben hat. Für Ktesias war Indien ein Wunderland mit märchenhaften Schätzen und fabelhaften Tieren, und seine phantasievollen Schilderungen haben sicherlich noch die Einbildungskraft der Portugiesen und Spanier auf ihren Entdeckungsfahrten beeinflusst.
Die Eroberungsreisen Alexanders des Grossen stehen in der Geschichte ganz einzig da. In zehn Jahren unterwarf er nicht nur das weitausgedehnte und mächtige Reich der Perser, drang im Osten bis in Indien hinein und eroberte im Westen Aegypten, sondern er erschloss auch alle diese Länder auf Jahrhunderte hinaus der griechischen Kultur, er brachte lange unterdrückte Völker zu neuem Leben und leistete unendlich viel für die Wissenschaft. Sein Heer wurde durch einen ganzen Stab von Feldmessern, Astronomen, Mathematikern und Naturforschern begleitet, die alles, was ihnen bemerkenswert erschien, aufzeichnen mussten. Ueberall wurden griechische Kolonien und Städte gegründet. Lateinische Schriftsteller haben 70 Städte mit dem Namen Alexandria gezählt, von denen noch heute die grössere Hälfte besteht, nur dass die Namen sich zum Teil sehr verändert haben. Alexander liess auch das Indische Meer bereisen, und sein Seefeldherr Nearchos untersuchte auf einer fünfmonatigen Küstenfahrt den Weg von der Mündung des Indus bis zur Mündung des Euphrat. Für seinen Lehrer Aristoteles liess Alexander sorgfältig alles Interessante aus der Naturgeschichte sammeln und ermöglichte ihm dadurch einen grossen Teil seiner wissenschaftlichen Arbeiten.
Sehr früh, schon mit 32 Jahren, starb Alexander in Babylon, aber sein Werk war in der Hauptsache getan, und seine Nachfolger, die Diadochen, die sich in das gewaltige Reich teilten, sorgten auch weiterhin für die Ausbreitung der griechischen Kultur. Durch ganz Vorderasien bis nach Indien wurden Heeres- und Handelsstrassen angelegt, und vor allem waren es die Ptolemäer in Aegypten, die Alexandria an der Nilmündung zur Herrin über das Mittelländische und Rote Meer und auch zugleich zu einem Mittelpunkt des damaligen wissenschaftlichen Lebens machten. Die Stadt wurde der grösste Handelsplatz der Welt, so dass die Ptolemäer in den 300 Jahren ihrer Herrschaft ungeheure Schätze ansammeln konnten. In der Alexandrinischen Bibliothek wurde alles gesammelt, was es überhaupt an wissenschaftlichen Schätzen im Altertum gab, und das Museion entwickelte sich zu einer Universität und Lehrstätte von nie wieder erreichter Höhe, die die grössten Denker und Dichter jener Zeit vereinigte. Eratosthenes, der Vorsteher der Bibliothek, ein grosser Astronom und Mathematiker, gab als erster ein vollständiges, systematisches Lehrbuch der Geographie heraus, das vier Jahrhunderte lang von grösster Bedeutung blieb. Er versuchte auch als erster durch eine genaue Gradmessung den Umfang der Erde festzustellen und gab eine sehr wichtige Weltkarte heraus. Allerdings nahm er fälschlich an, dass sich Asien viel weiter nach Osten erstrecke, als es tatsächlich der Fall war, ein Irrtum, der auch später nicht berichtigt wurde und noch im 15. nachchristlichen Jahrhundert eine Rolle spielte. Jedenfalls hätte sich Kolumbus niemals über den Ozean gewagt, wenn er gewusst hätte, wie gross die Entfernung von der Küste Europas bis zur Ostküste Asiens war. Um 150 n. Chr. hat dann Hipparchos vor allem auch die astronomischen Kenntnisse seiner Zeit bereichert und zuerst auch eine nach Länge und Breite in Gradnetze eingeteilte Sternkarte entworfen, durch die man zugleich jeden Punkt auf der Erde mathematisch festlegen konnte.
Читать дальше