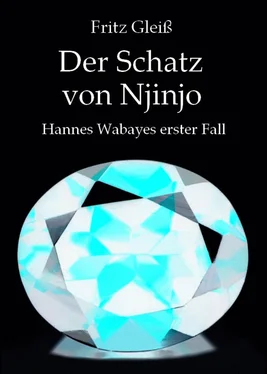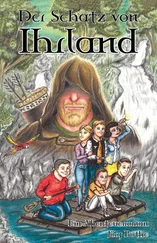Während das Weihnachtsfeuer niederbrannte, wurde Kaishes Bericht immer stockender. Der mzee bemerkte die Unruhe seiner Söhne, die sich von seiner Kunst entfernten. Nicht so sehr von seinen verkitschten Dorfcollagen, nein, von eben dieser Kunst, zu Geld zu kommen. Wie er die Bilder an die Leute brachte. Das kannten wir längst zu genüge: Wie er auf fettwanstige Biertrinker zuzugehen weiß, rosarote, gelbe wie auch dunkelbraune, die ihm am Ende ein Almosen geben und seine Bilder unter all den schwitzend nassen Flaschen auf dem Tisch dann glatt vergessen.
Nein, jetzt wollten wir von Hatten hören, wie es zum x-ten Mal gewesen war: Mitten unter Fremden den Kilimanjaro zu bezwingen, ihnen den Weg aufs Dach Afrikas zu zeigen und Geld abzuknöpfen – so viel wie möglich und doch nie genug, um alle Beteiligten zu befriedigen: die Träger, den Koch, die bestochenen Parkangestellten, Zulieferer und alte Rechnungen. Selten nur langte es für die Schulden, geschweige denn für Wünsche. Schinderei für Shillingfuchser: Wie ertrug Hatten das bloß immer wieder? Okay, über die Jahre war er aufgestiegen, vom simplen „Porter“ zum echten Tourguide, der aber auch stets den härtesten Part bis zum Gipfel zu bestreiten hatte, elfhundert Höhenmeter mehr als die meisten seiner Träger. Wie schafft der das, was treibt ihn jedes Mal von neuem hoch ins Eis? Und vor allem: Was hatten ihm seine wazungu dieses Mal als Tipp geschenkt, was freiwillig noch dazugezahlt?
Es war gut ausgegangen, dieses eine Mal. 250 Dollar in Devisen, 300.000 Shilling obendrauf, nirgends mehr Verbindlichkeiten. Doch neben dem Geld trieb Hatten auch der Traum vom großen Glück. Glück wie beim Lottospielen: Einmal das große Los ziehen, den richtigen mzungu führen, Bill Gates, Bono, Clooney oder so, der sich dann lebenslang erkenntlich zeigt. Der so viel Geld und Einfluss hat, dass sich davon anhaltend profitieren lässt. Und dieses Mal zu Weihnachten steckte in Hattens Geschichte tatsächlich ein Tipp, heiß wie ein künftiger Hauptgewinn: Sie wies auf einen grandiosen kolonialen Schatz.
Vaters Kunde saß derweil in „Key’s Hotel“ beim dritten Bier und sinnierte in der warmen Nachtluft vor sich hin. Vor ihm dünsten auf plüschigen Ledersesseln die erstandenen Pappen, senkrecht, sodass er sie betrachten kann. Um ihn herum die alte, verfallene Pracht britischer Kolonialhotels: der stillstehende Ventilator an der Decke, der Riesenkühlschrank, die Massivholz-Theke aus Tropenholz im matten Dämmerlicht, die Whiskeyflaschen. Und davor drei unbeschäftigte, livrierte Kellner, würdig ergraut in weißer Uniform auf dunkler Haut.
„Noch ein Safari, master ?“
„Danke, gern, gleich, danke.“
Wenn sie einen schon master nennen müssen, will der Weiße wenigstens freundlich bleiben. Sein buntes T-Shirt, typischer Dress hellhäutiger Touristen, zeigt noch kaum Flecken, keinen Schweiß. Zwei Sessel weiter fläzt sich die hotelübliche Schöne der Nacht auf der Suche nach ihrem Weihnachtsmann. Finn Schütte ist nicht interessiert. Er ist froh, zurück in der Zivi-lisation zu sein, freut sich übers Konsumieren und träumt von Trude, Geld und Afrika. Vom Abenteuer.
Gerade erst hat er eines der größten Abenteuer seines Lebens mit Bravour bestanden. Diese Wanderung bis an alle Grenzen, bis vors Umfallen. Den strapaziösen Aufstieg auf Afrikas gewaltigsten Berg, den Kilimanjaro, quer durch alle Klimazonen dieser Erde, durch dichten Regenwald, über Flechten verhangene Steilhänge, verbrannte Heide, polare Tundra und verschneite Mondlandschaften. Die dünne Luft, die mit jedem Meter trockener wird. Dabei der ständig lauernde Kopfschmerz, die völlige Überanstrengung und diese dumme, unbeantwortbare Frage: Warum, warum zum Teufel mach ich das bloß hier? Warum tu ich mir das bloß an? Schließlich dann, beim Sonnenaufgang am letzten Morgen, das in allen Farben glitzernde Licht der Gletscher: Das pure Glück nach tagelanger Quälerei. Und wie er, Finn Schütte aus Norddeutschlands Tiefebene, auf dem Gipfel angekommen, mitten im Eis am liebsten eingeschlafen und beinah erfroren wäre, hätte ihn nicht sein Bergführer Manhatten unbändig zäh voran getrieben.
Er hatte es sich so nett vorgestellt. Erst ein paar Tage Ausspannen, zur Akklimatisierung Bergwandern durch exotische Landschaft und mal eben einen Fast-Sechstausender besteigen, dann ab in die alte Hauptstadt zum Recherchieren. Stattdessen Quälerei hoch fünf und tagelang dieses „ pole pole “! Wie oft hatte er diese Litanei gehört! Anfangs hatte er die jungen Männer nicht verstanden, die ihn auf Schritt und Tritt fast aufdringlich begleiteten und sein Gepäck bergauf beförderten. Dann grinste er unsicher und trabte etwas schneller, um sie abzuhängen. Bis es Manhatten ihm und seinen Mitwanderern endlich erklärte:
„ Sorry, ladys and gentleman, so sorry , dass hier niemand ihre Sprache spricht. Meine Leute sind happy, dass sie in der Schule wenigstens ein paar Brocken englisch gelernt haben. Aber sie sind erfahren: Unseren Gästen soll nichts passieren! Deshalb werden Sie so oft gemahnt: Langsam gehen, pole pole ! Bloß nie außer Atem kommen! Durchatmen! Nur so können Sie den Gipfel schaffen.“ War da etwa Spott in der sonoren Stimme?
„Wie weit ist’s denn morgen?“
„Keine zwölf Kilometer ...“
„Was, nur drei Stunden?“
„Nein, sechs.“
Fürs Spöttische schien dieser schmächtige Mann mit den drahtigen Beinen unter der gefleckten Outdoorhose nicht allzu viel übrig zu haben.
Am nächsten Abend war Schütte trotz seines dicklichen Umfangs einer von zweien aus der Gruppe, dem nicht hundeelend war. Oder vielleicht gerade deswegen. Erneut hatten sie fast tausend Höhenmeter bis zur zweiten Hüttenanlage hinter sich gebracht. Der Koch hatte Steak, Kartoffeln und Möhren aufgetischt, die aber kaum mehr jemand essen mochte. Ihr guide Manhatten zeigte Mitleid mit den Elenden. „ Ladys and gentleman , dass ihnen der Kopf brummt und sie sich elend fühlen, ist völlig normal. Nicht, dass ich’s ihnen wünschen würde, aber was glauben sie denn, wo sie sind! Fast 4000 Meter überm Meeresspiegel, das tut nun einmal selten gut. Wir wär’s mit zwei Aspirin?“
Schütte dürstete nach Gehaltvollerem. „Gibt’s hier oben vielleicht auch Bier?“ Und siehe da: Selbst das wusste Manhatten aufzutreiben. Gegen Cash natürlich, aber nur geringfügig teurer als in „Key’s Hotel“: Manhatten, dieses Schlitzohr! Eine halbe Kiste hatte er seine Leute auf die Hütte schleppen lassen. Da war der Flachländer Schütte angetan. Am Berg kannte sein Bergführer sich wirklich aus.
Von Ökonomie jedoch, das dünkte Schütte, verstand Manhatten wenig. Nach dem zweiten Bier – Gewinnspanne kaum 50 Prozent! – hatte der sich zu ihm in die Hütte gesetzt und seinem wohlbetuchten Kunden aus dem Norden einen langen Vortrag gehalten über Luxus und Korruption, über fremdes, eigenes und gemeinschaftliches Eigentum, von dem es in Tansania nur so wimmeln würde, einen Vortrag, in dem – wie Schütte fand – fast gar nichts stimmte. So behauptete der Bergführer doch glatt, Korruption im eigentlichen Sinne sei in Tansania nicht verbreiteter als andernorts. Natürlich sei es zum Haareausraufen, wenn vor Gericht immer der Recht bekomme, der dem Richter das meiste Geld zustecke. Aber sei das nicht andernorts ganz ähnlich? Wer sich den besseren Anwalt leisten kann, gewinnt? Nur die wenigsten, die hierzulande ihr karges Einkommen aufbesserten, indem sie sich bestechen ließen, seien echt korrupt. Man schaue sich doch auch mal an, von welch absurd niedrigen Beträgen hier die Rede ist. Wer mit dem Gehalt eines Angestellten von vielleicht einer halben Million Shilling zehn Personen durchbringen soll, für den sind 100.000 mehr – keine 50 Euro! – eine existenzielle Hilfe. Dass sei doch für eine passende Dienstleistung, z.B. den etwas weniger stark verzögerten Anschluss ans Stromnetz, ein ganz passabler Preis, der werde überall gezahlt. Die allermeisten seiner Landsleute seien zwar einem Deal nie abgeneigt, aber eben nicht verrucht. Der reine Selbsterhaltungstrieb.
Читать дальше