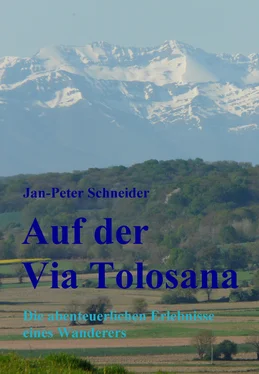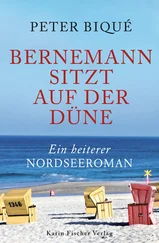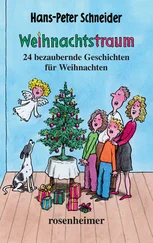Am Abend in der Gîte sitze ich im flackernden Kerzenlicht mit zwei anderen Wanderern gemütlich zusammen, die noch dazugekommen sind, Annick, eine junge Studentin, und Kai, ein älterer Herr mit schlohweißem Haar und Schnauzer. Die Studentin berichtet, dass die Germanistik-Fakultät dieses Semester ein Seminar zum Thema „Mordfall Jesu“ anbietet: „Die Aufgabe der Seminarteilnehmer besteht darin, die Darstellung von Prozess und Kreuzigung Christi in den Evangelien mit Hilfe der historisch-kritischen Auslegung unter Berücksichtigung außerbiblischer Quellen auf Plausibilität zu untersuchen.“ „Mordfall Jesu! Das ist doch abwegig!“ empört sich Kai, mit großen, dümmlich Augen hinter seiner Brille. „Das war ein regulärer Strafprozess nach römischem Recht. Die Anklage lautete auf staatsfeindlichen Aufruhr, Anstiftung zum Aufstand und Majestätsbeleidigung. In Anbetracht dieser schweren Delikte war das Todesurteil nur konsequent. Von einem Justizmord kann nicht die Rede sein!“ erklärt Kai im Brustton der Überzeugung. „Mordfall Jesu“, schüttelt Kai verständnislos mit dem Kopf. Ich nippe leicht am Weinglas. Annick jedoch reagiert pikiert: „Bei dem Seminar geht es doch ausschließlich darum, verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der Kreuzigung zu untersuchen, und nicht darum, den Seminar-Titel mit juristischer Spitzfindigkeit zu kritisieren. Und überhaupt,“ gibt Annick schnippisch zurück „sind denn Geißelung und Dornenkrone mit einem regulären Strafprozess vereinbar?“ „Selbst wenn im Rahmen des Ermittlungsverfahrens verschärfte Verhörmethoden zur Anwendung gekommen sein sollten,“ blitzen die Augen des Juristen auf, „würde es sich dabei lediglich um unbeachtliche Verfahrensfehler handeln, die kein Beweisverwertungsverbot nach sich ziehen würden. Der Grundsatz des fairen Verfahrens müsste nämlich – angesichts der Schwere der im Raum stehenden Straftatbestände – in der Abwägung des Einzelfalles ganz sicherlich zurücktreten. Im übrigen“ fügt der Jurist aus Karlsruhe hinzu „konnte sich Jesus als einfacher Einwohner der Provinz Judäa nicht auf das römische Bürgerrecht berufen, das ihm im Rahmen des Strafprozesses gewisse Privilegien gewährt hätte. Denn die Provinz Judäa war römisches Besatzungsgebiet, in dem lediglich das gewöhnliche Feindrecht zur Anwendung kam.“ „Ich bin mir nicht sicher, ob die Rechte von Jesus Christus im Prozess ausreichend gewahrt wurden.“ erklärt Annick weinerlich, während sich ihre Kulleraugen mit Tränen füllen. „Im Rahmen der Hauptverhandlung hatte der Angeklagte doch ausreichend Gelegenheit, zum Tatvorwurf Stellung zu nehmen.“ stellt Kai klar, während er mit großen, verständnislosen Augen auf Annick blickt. „In der richterlichen Vernehmung durch Pontius Pilatus räumte der Angeklagte doch selbst ein, dass er sich die Königswürde anmaßte. Kaiser Augustus hatte aber nach dem Tod von Herodes das Tragen des Königstitels in dem einstigen Königreich Judäa ausdrücklich verboten. Mit der Anmaßung der Königswürde hatte Jesus daher die Autorität des römischen Kaisers öffentlich in Frage gestellt.“ Eine betretene Stille tritt ein. „Der Mann legt Gesetz und Recht wahrlich meisterhaft aus, wie es wohl nur deutsche Juristen nach gründlichem Studium beherrschen.“ denke ich bei mir und entkorke die nächste Flasche Wein „In einem schwierigen Abwägungsprozess führt er alle relevanten sachlichen Gesichtspunkte – immer unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit selbstverständlich – einer zutreffenden rechtlichen Würdigung zu.“ Ich fülle die Weingläser nach. „Er wendet das Recht mit deutschem Augenmaß auf den konkreten Einzelfall an.“ „Abgesehen davon, „ fügt der Jurist aus Karlsruhe dümmlich, aber zugleich tiefernst hinzu „stellte der Einzug in Jerusalem auf einem Esel eine ungeheuerliche Provokation dar, die den Bestand der römischen Herrschaft auf dem Gebiet des einstigen Königreiches Judäa in seinen Grundfesten erschütterte. Mit seiner Kritik an dem Tempelkult am Vortag des Pessach-Festes schürte Jesus doch vorsätzlich Unruhen und Aufruhr in Jerusalem und führte damit eine gefährliche Destabilisierung der politischen Verhältnisse in den Gebieten des einstigen Königreiches Judäa herbei.“ Annick schaut ihn fassungslos an. „Aus Gründen des Staatsräson“ fügt er ungerührt hinzu „musste Pontius Pilatus hart durchgreifen und die Todesstrafe gegen den Rädelsführer verhängen.“ „Todesstrafe!“ ruft Annick empört aus. „Sicherlich ein hartes Urteil.“ räumt Kai unumwunden ein. „Aber das harte Strafmaß macht den Strafprozess noch lange nicht zum Justizmord. Ansonsten müsste man ja jede Hinrichtung in Florida oder Peking als Justizmord anprangern.“ Mit großen tränengefüllten Augen schaut Annick ihn an. „Das Todesurteil gegen den Nazarener“ stellt der Jurist aus Karlsruhe ungerührt fest „war rechtlich einwandfrei.“ „Lasst uns anstoßen!“ fordere ich Annick und Kai auf und hebe das Glas „Auf die Via Tolosana!“ „Auf die Via Tolosana!“
Kapitel 6
6. Montarnaud – St.-Guilhelm-le-Désert: Über die Teufelsbrücke ins Kloster
Am frühen Morgen setze ich mich vor der Herberge auf der Treppe, um – bei angenehmen Frühlingstemperaturen – die letzten Vorbereitungen für die heutige Etappe zu treffen. Wenige Minuten später verlasse ich das beschauliche Montarnaud. Bereits am Rande der Ortschaft wartet eine kurze, aber heftige Steilstufe. In engen Serpentinen kämpfe ich mich den kräftezehrenden Steilanstieg empor. Auf dem Schichtkamm atme ich erst einmal tief durch und blicke verschwitzt auf das über 100 Meter tiefer gelegene Montarnaud hinab. Gut aufgewärmt steige ich auf der anderen Seite auf verlassenen Waldpfaden talabwärts, bevor ich nach La Bossière, einem kleinen Cevennen-Dorf, hinaufsteige. „Eigentlich merkwürdig, dass die zwei Pilger mit der Prozessionsstandarte und die beiden Wanderer aus Florenz noch nicht vor mir auf der Strecke aufgetaucht sind.“ denke ich bei mir. Nach einer kurzen Pause am Dorfbrunnen, auf dem Place Hipolyte Negrou, folge ich dem Schotterweg einer aufgegebenen Eisenbahntrasse. Die Sonne brennt mittlerweile erbarmungslos auf mich herab. In sengender Hitze quäle ich mich über die Schotterpiste, während nur wenige Meter entfernt ein kühler Baggersee Abkühlung verspricht. Nach Unterquerung einer unscheinbaren Eisenbahnbrücke darf ich endlich die Schotterpiste verlassen und biege nach links auf einen Feldweg ab, der mich ein kleines Tal aufwärts führt. Auf Fußpfaden durch einen Eichen- und Lorbeerwald gelange ich in ein Weinanbaugebiet, in dem Winzer gerade dabei sind, Schnittarbeiten an den Weinstöcken durchzuführen. Während dunkle Regenwolken den Himmel zunehmend verfinstern, steige ich zum Dorf Aniane hinab. Kaum habe ich den Ort durchquert, setzt schon leichter Nieselregen ein. Eilig haste ich durch Weinfelder und Olivenhaine, denn schließlich möchte ich nicht unbedingt auf freiem Feld in ein heftiges Unwetter geraten. Bald überquere ich die Landstraße D27EE1, laufe im Eiltempo einen Weinberg hinauf und schlage dann den Feldweg in Richtung Jean-de-Fos ein. Zwischen den Weinfeldern lässt der Nieselregen dann unvermittelt nach, stattdessen kommt mir eine Hundebesitzerin mit ihrem Bordercollie entgegen. „Die Strecke bis St.-Guilhelm-le-Désert ist nicht mehr weit.“ verspricht sie mir. „Bei Jean-de-Fos müssen Sie die Teufelsbrücke über den Hérault überqueren und auf der anderen Seite der Schlucht flussaufwärts folgen.“ Wie sich herausstellt, wohnt die Hundebesitzerin selbst im Dorf. „In der Hochsaison ist St.-Guilhelm-le-Désert ein touristischer Anziehungspunkt, vor allem das Kloster Gellone aus der Zeit von Charlemagne.“ schwärmt sie mir vor, während ihr Bordercollie übermütig herumtollt. „Stop!“ ruft sie ihrem Hund zu. „Down!“ Ich blicke leicht verdutzt. „Mein Bordercollie ist mehrsprachig.“ erklärt sie mir. Und ich befürchte beinahe, das meint sie ernst. Wir verabschieden uns und ich ziehe weiter auf Jean-de-Fos zu, das unmittelbar am Eingang der Hérault-Schlucht liegt. Der Hérault hat sich dort bereits tief in das zerklüftete Felsgestein eingegraben und rauscht wild schäumend durch das enge Flussbett. Auf dem Pont du Diable, einer eleganten, zweibogigen Brücke aus dem 11. Jahrhundert, überquere ich den Hérault und steige auf der anderen Seite flussaufwärts in die enge Felsschlucht. Auf beiden Seiten ragen karg bewachsene Felswände steil empor. Auf winzigen, von Menschen angelegten Terrassen klammern sich kleinwüchsige Olivenbäume verzweifelt an das nackte Felsgestein. Auf engen Fußpfaden, am Rande der steil abfallenden Felswände, wanke ich vorwärts, immer weiter in die Hérault-Schlucht hinein. Die bislang zurückgelegte Strecke steckt mir bereits in den Knochen, an jeder neuen Flussbiegung erwarte ich ungeduldig St.-Guilhelm-le-Désert. Stattdessen marschiere ich an einer romantischen Burgruine vorbei, die auf einem, von dem Hérault umspülten Felsblock thront, und steuere auf die nächste Flussbiegung zu. Doch anstelle von St.-Guilhelm-le-Désert entdecke ich den Eingang zur Grotte du Clamouse, einer Tropfsteinhöhle, die sich im Inneren des Berges versteckt. Dann endlich, bei Einbruch der Dämmerung, erreiche ich das mittelalterliche Dorf St.-Guilhelm-le-Désert.
Читать дальше