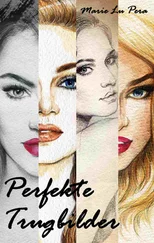Dort komme ich nur kurz zu liegen, bevor ich den steilen Abhang herunterkugle. Immer schneller dreht sich die Erde um mich herum. Ich spüre Äste, die über meinen Körper peitschen, aufgewirbeltes Laub, Erde, Farne, Gestrüpp, Geröll, was sich in meine Haut gräbt, und durch das ich immer schneller zu werden scheine.
An Schmerz ist noch gar nicht zu denken. Dafür stehe ich wahrscheinlich noch unter Schock.
Aber er wird kommen, da bin ich mir sicher.
Diese Tortur scheint kein Ende zu nehmen. Immer wenn ich glaube, endlich irgendwo zu liegen zu kommen, stürze ich tiefer hinab, betäubt von meiner Angst, die mich lähmt.
Ich wünschte mir, ohnmächtig zu werden, sodass ich nicht mitbekomme, wenn ich mir gleich das Genick breche, doch ich schaffe es nicht.
Schaffe es nicht mal, die Augen zu schließen. Spüre nur, wie mir Teile meines Ganzkörperanzuges vom Leib gerissen werden.
Plötzlich bremst etwas meinen Rutsch, das sich wie eiskalter Matsch anfühlt. Nicht, dass ich so etwas jemals auf meiner Haut gefühlt hätte, doch genauso stelle ich es mir vor. Einen Wimpernschlag später hebt es mir jäh den Magen aus.
Erneut falle ich in die Tiefe bis ich auf eine Oberfläche auftreffe, die sich wie Beton anfühlt und mich einen Atemzug später in eiskaltes Nass einhüllt.
Tosende Wassermassen sprudeln um mich herum, ziehen mich mit sich in die Tiefe und nehmen mich mit auf ihre Reise, als wäre ich direkt auf einen fahrenden Zug aufgesprungen.
Der Strom macht mit meinem Körper, was er will, lässt mich in Richtung Wasseroberfläche treiben, nur um mich kurz vorm Ziel wieder runterzuziehen. Immer wieder wirbeln tausende Luftbläschen um mich herum.
Sofort fühle ich mich in die Schneekugel hineinversetzt. Ich werde darin ertrinken.
Luft – ich brauche sie – und zwar schnell.
Aus reinem Überlebensinstinkt rudere ich mit den Armen, doch ich vermag nichts gegen die Wucht des Wassers auszurichten, die meinen Körper immer wieder zu Bewegungen zwingt, die ich nicht kontrollieren kann. Ich werde von den Fluten mitgerissen, als wär ich ihr blinder Passagier.
Der Gedanke daran, dass ich gar nicht gut schwimmen kann – was man zumindest von ein paar Mal Trockentraining und kurzen, panischen Planschbeckenaufenthalten aufschnappen kann – raubt mir zusätzlich den Atem, der schon lange aufgebraucht ist. Da zerrt eine Tiefenströmung an meiner Taucherbrille und erinnert mich daran, dass sie genau für dieses Medium konzipiert wurde, obwohl ich sie jahrelang zweckentfremdet hatte.
Wie eine Irre halte ich sie an meinen Kopf, damit sie nicht von der Strömung fortgerissen wird und sauge die gesamte Luft auf einmal aus dem Schnorchel.
Aber das war nichts weiter als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die ersten Anzeichen, die einen nahenden Erstickungstod einläuten, versetzen mich in absolute Hysterie, bis ich an meinen Füßen das Geröll des Flussbettes spüre.
Mein nächster Atemzug ist schon längst überfällig, dennoch schaffe ich es, mich mit letzter Kraft mit meinen Beinen abzustoßen, an die Wasseroberfläche zu gleiten, sie zu durchstoßen, mir das Mundstück des vollständig mit Wasser gefüllten Schnorchels runterzureißen und meine Lungen keuchend mit dem rettenden Sauerstoff zu füllen, bevor ich erneut viel zu schnell untergehe.
Abermals werde ich hinfort gespült, unfähig, der unfreiwilligen Reise aus eigener Kraft ein Ende zu setzen. Dafür sind meine Ärmchen viel zu schwach. Ehrlich gesagt habe ich Bewegungen jeglicher Art grundsätzlich vermieden.
Das hab ich jetzt davon.
Ungeachtet dessen, dass das Flussbett gar nicht tief zu sein scheint, ist das hier trotzdem ein Kampf ums nackte Überleben. Dennoch schaffe ich es immer wieder, mich abzustoßen, um hustend nach etwas Atemluft zu ringen.
Die Verschnaufpausen hätte mein Schnorchel überbrücken können, hätte ihn mir die Kraft der Wassermassen nicht gerade mitsamt Taucherbrille entrissen. Nur einem Moment der Unachtsamkeit ist es zuzuschreiben, dass es so weit kommen konnte.
Meine Hand schnellt zwar vor, ist aber zu langsam, um die Brille noch zu erhaschen. Sie wird hinfortgespült. Mit ihr, das Püppchen, das nun in einer Rolle gedreht wird, sodass die Kapuze ihres Anzuges an den Unterwasserwurzeln hängenbleibt.
Im Nu umspült mich das Schwarz meiner Haare, die nun unbändig der Strömung ausgesetzt sind. Sie erinnern mich an die Algen um mich herum, die um meinen Körper herum streicheln, was mich noch mehr in Panik versetzt.
Meine Kräfte schwinden mit jedem weiteren Versuch, Luft zu erhaschen. Noch dazu muss ich immer wieder krampfhaft husten, wenn ich Wasser, das über meinen Kopf schwappt, irrtümlich einatme oder schlucke.
Ich kann nicht mehr.
Meine Lungen brennen wie Feuer, während meine Glieder schön langsam von der Eiseskälte taub werden.
Verzweifelt sehe ich das, in der Schneekugel eingeschlossene, Püppchen vor mir. Wie es vergeblich versucht, mit der Faust an das Glas zu hämmern, um sich daraus zu befreien.
Nur dass in meiner Vorstellung das Püppchen an die, mit Schneesternen bewachsene, gefrorene Fensterscheibe meines, von Wasser gefluteten, Zimmers pocht. Den grinsenden Puppenspieler vor sich, der auf der Schaukel sitzt und dabei zusieht, wie mir mein eigenes, kleines Hochsicherheitsgefängnis zum Verhängnis wird.
Wie es zu meinem Grab wird.
Im nächsten Augenblick nimmt die Geschwindigkeit des Wassers an Fahrt auf. Es fühlt sich so an, als ginge es bergab, bevor ich in eine Art Weiher stürze, in dem die Fluten plötzlich gefühlt zum Stillstand kommen.
Herabfließende Wassermassen drücken mich tief in das Flussbett. Ein kleiner Fischschwarm fährt auseinander und bringt sich vor mir in Sicherheit. Ich erschrecke mich, da mich einer von ihnen am nackten Arm streift. Mein Angstschrei schafft es nur in Form von Luftblasen an die Oberfläche.
Schwarze Punkte flackern bereits in meinen Augen, als mich eine tiefliegende Flussbettströmung erfasst und mich weiter schwemmt.
Meine Hand tastet suchend umher, stößt auf eine Wurzel, an der ich mich hochziehe. Ich schaffe es gerade mal meinen Kopf bis zu meinen Nasenlöchern an die Wasseroberfläche hochzuziehen, bevor die Kraft des Wassers die Umklammerung meiner Finger löst, nur um mich weiter mit sich zu tragen.
Wie lange dieser Überlebenskampf dauert, vermag ich nicht zu sagen. Aber eins weiß ich genau: Die Reise scheint ein jähes Ende zu finden, als mein Körper an etwas hängenbleibt.
An einem Netz, um genau zu sein.
Ich zapple wie wild geworden, versuche, mich daraus zu befreien, doch verheddere mich nur noch mehr in den feinen Stricken, die sich wie Fesseln um meinen Körper schlagen, als wären es Tentakel eines Tintenfisches, der nicht vorhat, mich je wieder loszulassen.
Je mehr ich mich bewege, desto fester schließen sie sich um mich wie ein Kokon. Ich weiß, dass ich in einer Todesfalle sitze. Warum ich mich immer noch dagegen zur Wehr setze, obwohl ich chancenlos bin, muss einem Überlebensmechanismus zuzuschreiben sein, der automatisch abläuft, denn zu einem klaren Gedanken bin ich nicht mehr fähig.
Plötzlich taucht etwas über mir ins Wasser ein. Ich kann feine Linien erkennen, die das Nass kurzzeitig teilen, bevor sie kribbelnd auf meine Haut treffen. Immer mehr von ihnen durchbohren die Wasseroberfläche wie kleine Pfeilgeschosse.
Und dann flackern auch schon wieder die schwarzen Punkte in meinen Augen auf. Da ist nur ein Gedanke, der immerwährend durch meinen Kopf schießt: Die Angst begleitet mich bis zum Schluss. Nicht mal jetzt ist sie gnädig und lässt mich gehen. Gewährt mir ein bisschen Frieden.
Nein, sie wird mein letzter Gedanke sein.
Und dann passiert es. Der Atemreflex setzt Unterwasser ein und füllt meine Lunge komplett mit dem falschen Element, was mich die Augen im Schock aufreißen lässt.
Читать дальше