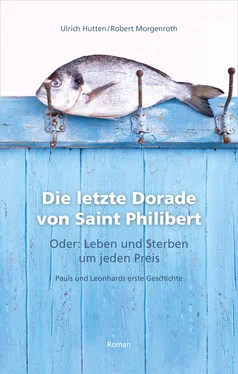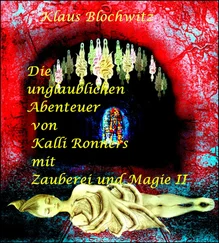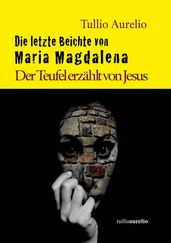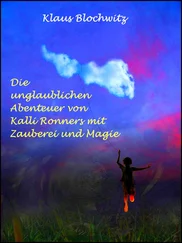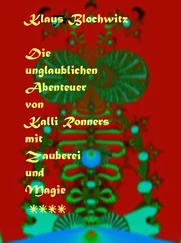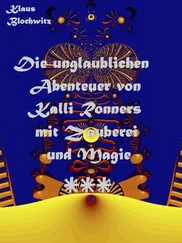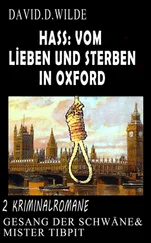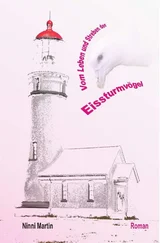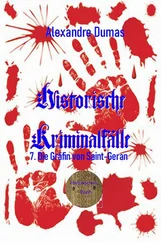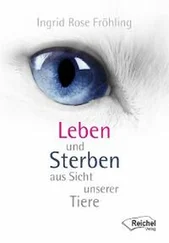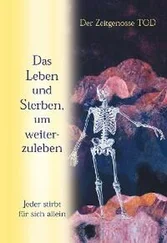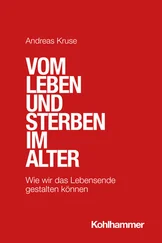Der kahlköpfige Bürgermeister le Pont kannte sein einheimisches bretonisches Wahlvolk und wusste, was es von ihm erwartete. Er hielt die Schlussworte der Zeremonie kurz und launig. Geschickt balancierte er zwischen politisch erforderlicher Distanz zum Verblichenen und einem menschlich unumgänglichem Minimum an geheucheltem Mitgefühl. Kein Unterton, der auf irgendeine Feindseligkeit hätte schließen lassen, oder umgekehrt, was noch schlimmer gewesen wäre, auf heimliche Kumpanei. Stattdessen eine pflichtschuldige, routinierte Würdigung des edlen Spendersinns eines Mannes, der so früh, viel zu früh, aus dem Leben gerissen worden war.
Kaum hatte sich des Bürgermeisters Mund geschlossen, da leerte sich das Kirchlein schon. Und der Organist quälte ein letztes Mal sein Instrument. Charles Dupont hatte gehört, was er hören wollte. Es zog ihn zu Chantal.
*
Die zwei blonden Mädchen hatten zum Joggen am Strand ihr schulterlanges Haar zu wippenden Pferdeschwänzen gebunden. Hell und fröhlich schaukelten ihre Schweife im Rhythmus der Schritte. Sie stoppten jäh, als sie den toten, schon aufgedunsenen Körper entdeckten. Die forensische Obduktion ergab zweifelsfrei die Identität der Leiche. Zugleich waren an ihr unzählige Hämatome und Verletzungen zu erkennen, ein zerschossenes Knie, Brandwunden und ein kreisrunder Einschnitt um den Hals, der darauf schließen ließ, dass eine Drahtschlinge diesem Leben ein endgültiges Ende gesetzt hatte. Dieses Mal würde er nicht wieder auferstehen. Charles Dupont war brutal gefoltert, erwürgt und dann im Meer entsorgt worden wie lästiger Abfall. Er musste doch zu laut geschnarrt haben, irgendwo, an der falschen Stelle. Noch nicht einmal die Strömung war so gnädig, ihn ins Paradies zur Insel seiner Träume zu tragen. Sie hatte ihn gnadenlos an die harte bretonische Küste zurückgeworfen.
Der Polizei blieb nichts übrig, als alle Spuren sorgfältig zu sichern. Und in Paris das Grab Duponts zu öffnen, wo man ihn auf seinen eigenen Wunsch im Friedhof von Montparnasse zur letzten Ruhe gebettet hatte. Dort fanden die Beamten einen Sarg, gefüllt mit Muschelkalksteinen und dem Kadaver eines toten Hundes.
Zweites Kapitel: Zwei Freunde und ein Besäufnis
Es gibt Tage, die vergehen so spurlos wie eine Burg aus Sand, zu nah am Wasser gebaut. Man macht, man schaufelt, man hat auch seine Freude. Aber, kaum ist man weg, kommt die erste Welle, spült Burg und Graben zu Hügeln weich, die nächste ebnet Berg und Tal zu sanften Bodenwellen ein, die letzte wischt sie vollends weg, als wäre nie etwas gewesen. Sie mehren sich, seit er im Ruhestand lebt, solche Tage. Seit Merkwürdiges seltener wird, gehen sie unbemerkt verloren, zerrinnen unmerklich im Bewusstsein, verschwinden still und leise aus dem Gedächtnis, versinken wie Sand im Wasser und Wasser im Sand. Auch heute war so ein Tag und ist schon wieder vorbei.
Fernsehbilder dringen auf ihn ein, heftiger als sonst. Sie kommen von nah, aus Europa, die täglichen Fernsehnachrichten leben vom Maidan, Brandaktuelles schwarz-weiß gezeichnet, in farbigen Pixeln und HD-Qualität, Barrikaden, Rauch und Feuer, gepanzerte Fahrzeuge. Showdown, blutüberströmte Kämpfer, martialisch vermummte Frauen, Zöpfe unter Stahlhelm, tote Helden und fliehende Schurken. Europa sitzt auf dem Sofa und schaut zu, gespannt, wie in der Ukraine Menschen für Europa kämpfen und für sich selbst, für die Chance, dazu zu gehören, dabei zu sein. Das gibt es tatsächlich noch auf dem guten alten Kontinent, Sterben für ein besseres Leben, für eine Sehnsucht, für ein Zukunftsprojekt, für Grundrechte, für Mitbestimmung, für Freiheit. Derweil stehen in der EU freie Wahlen an. Und es interessiert kaum einen. Warum auch, wenn es nur noch um Zahlungen und Zahlen geht. Ein paar hundert Kilometer weiter wird dafür gestorben.
Die Wahrheit stirbt zuerst, Krieg ist ihr Karfreitag, auch wenn sie wieder aufersteht, nicht schon an Ostern, am dritten Tag, aber irgendwann, wenn Hinterbliebene, Journalisten oder Historiker, manchmal auch Polizisten, Querköpfe, Pazifisten oder Juristen keine Ruhe geben und sie wieder ausgraben. Menschen fallen auf dem Maidan und Aktien steigen auf dem Parkett. Im Fernsehbild die Toten. Nicht auf dem Schirm die Strippenzieher und die Oligarchen. Im Bild der fliehende Autokrat. Nicht im Bild die Schreihälse, die Neonazis, die Geheimdienste. Europa ohne Russland, das kann nicht gut gehen. Jedenfalls nicht lange. Kein gemeinsames europäisches Haus ohne ein Fundament, das alle trägt, ohne Räume, in denen sich alle aufgehoben fühlen. Eingriff, Angriff. Und Rückgriff auf alte Muster, Rückfall in vergangen geglaubte Zeiten. Maskierte Militärs, russische Milizen, Warnschüsse gegen Beobachter, Armee marschiert. Aufregung, nicht nur in Europa. Aus tiefen Schichten Geschichte kocht Magma hoch. Annexion. Das bequeme Sofagefühl wird brüchig. Angst kommt auf, kriecht tief in den Westen hinein. Und eine Stimmung, als wäre wieder kalter Krieg. Dünnes Eis.
Jetzt ist Dr. Leonhard Ross erleichtert, dass er nicht mehr Chef sein muss in einer Redaktion, nicht mehr dirigieren und formulieren muss, um im Blatt Linien und Orientierung vorzugeben, dass er auch nicht mehr einordnen und kommentieren muss für die sogenannte öffentliche Meinung, dass er sich nur noch seine eigenen Gedanken machen darf. Und die kann er für sich behalten. Oder heftig mit seinen Freunden diskutieren. Und seiner Freundin.
Er schaltet den Fernseher aus, stemmt sich ein wenig steif aus bequemer Sesseltiefe, holt seinen Black Bush aus dem Schrank, gönnt sich eine Daumenbreite dreifach aus Single Malt destilliertes, im Sherryfass gereiftes Goldgelb, schwenkt das Glas, erschnuppert die milde, aber verheißungsvolle Würze und tritt hinaus auf den Balkon. Es ist dunkel geworden draußen. Vogelstimmen mischen sich in Stadtlärm ein. Sein Blick wird magisch angezogen vom schimmernden Wasser, schweift hinüber zum See, verfängt sich in den Silhouetten der Hecken und Bäume. Deshalb wohnt er hier, weil er wassersüchtig ist, so wie andere nicht leben können ohne Weite oder ohne Berge oder ohne Mozart oder ohne Kneipen im Kiez. Eine Ente schnarrt vom Ufer herüber, findet Antwort. Der See hüpft im Wind. Er bewegt sich immer, aber immer anders, selbst wenn er stillzustehen scheint, bewegt er sich, unter spiegelglatter Oberfläche wie manchmal am frühen Morgen. Jetzt tanzt er silberschwarz unter dem halben Mond und die Trauerweiden baden ihre Zweige.
Am Uferweg streckt sich schräg ein Baum halb zur Erde, halb zum Himmel, sendet seine Äste aus und sein Gezweig, noch kahl, nackt, ins Leere. Tagsüber ist hier Getümmel, vor allem an den Wochenenden, ist alles auf Beinen oder Rad, Kinder hüpfen Trippeltrappel, Radler drängeln, Hunde streunen oder ziehen an der Leine, Väter schieben Kinderwägen, alte Frauen ihre Rollatoren, Jogger ziehen ihre Bahn. Jetzt ist Ruhe eingekehrt, niemand ist mehr unterwegs, das ferne Hochhaus schickt sein Fensterlicht herüber, eins überm andern, als stiege eine Lichterkette ins Dunkel hinauf. Über dem Horizont der Stadt mischt dunstiger Smog schwaches Rot und sattes Orange in den Himmel, aus der Luft malt irgendetwas bewegte Linien aus Licht hinein, darüber sitzen seidensilberne Sterne in durchsichtigem Schwarz.
Leonhard fröstelt ein wenig, nimmt einen Schluck, ergibt sich dem wilden Überfall auf seinen Gaumen, der sich brennend den Hals hinunterzieht, um sich warm und wohlig im Magen zu dehnen. Er träumt vor sich hin, denkt wieder, schon wieder an Karla, seine Freundin, fragt sich, ob er sie jetzt anrufen kann oder kurz zu ihr hinübergehen ins nahe Nachbarhaus, denkt nach, ob es gut war, sich hier niederzulassen im deutschen Nordosten, wo sich Weltkultur und Naturwelt, Ossi und Wessi, Hauptstadt und Residenz, Platte und Palast, Preußen und das neue Deutschland so innig berühren, freut sich, dass es so gekommen ist, dass er gekommen ist, hierher in diese Stadt, an diesen See, wo er seiner Freundin nah sein kann, dem Wasser und sich selbst.
Читать дальше