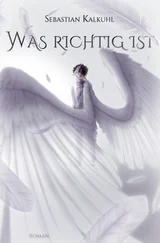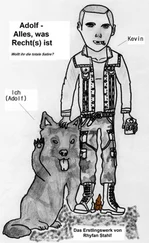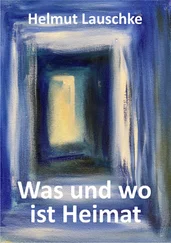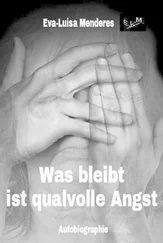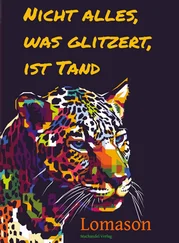Tobias Kaestli - Was war, ist wahr
Здесь есть возможность читать онлайн «Tobias Kaestli - Was war, ist wahr» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Was war, ist wahr
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Was war, ist wahr: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Was war, ist wahr»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Was war, ist wahr — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Was war, ist wahr», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Inwiefern die Philosophie hier hilfreich sein konnte, war mir nicht klar. Ich verstand, dass sich Portmann gegen den Menschen aus der Retorte wehrte, dass er die rationale Argumentation derjenigen in Frage stellte, die den besser angepassten Menschen durch genetische Veränderung erzeugen wollten. Die eugenischen Experimente, wie sie in Nazi-Deutschland betrieben worden waren, standen einem als schreckliche Abirrung der Wissenschaft vor Augen. Portmann plädierte dafür, in erster Linie Erziehung und Bildung als Mittel der Veränderung anzusehen. Dass er zudem gewillt war, die Naturwissenschaft der Philosophie unterzuordnen, überraschte mich, denn, so viel ich wusste, waren die Naturwissenschaften einer antiphilosophischen Tradition verpflichtet. Doch Portmann mit seinem ethisch geschärften Verstand sprach ihr eine neue wichtige Aufgabe zu: Weil die Naturwissenschaft nicht fähig sei, die Kritik an sich selbst in genügendem Mass zu entwickeln, weil sie alles ausprobiere, was machbar sei, und damit nicht nur Nutzen, sondern unter Umständen auch gigantischen Schaden anrichte, brauche es die Philosophie.
In meinem ersten Studiensemester interessierte ich mich vor allem für die Literaturgeschichte. Es war eher Liebhaberei als ernsthaftes Studium. Eigentlich las ich in ähnlicher Art, wie ich es schon als Gymnasiast getan hatte, ohne Plan und bestimmte Absicht Werke der Klassik, Romantik und des bürgerlichen Realismus, möglichst alles von Goethe, Novalis, Kleist und Gottfried Keller. Später kamen Büchner, Thomas Mann, Kafka, Brecht und ein wenig Hölderlin dazu. Manchmal diskutierte ich mit Peter Meyer über Texte, die er auch gelesen hatte. Er wohnte bei seinen Eltern in Nidau. In dieses Städtchen in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Biel waren auch meine Eltern gezogen, und ich hatte mein Zimmer in ihrer Wohnung. Peter und ich wohnten also nahe beieinander, und wir sahen uns oft. Er hatte sich wie ich für das Studium der deutschen Literatur und der Geschichte entschieden, wechselte aber später zur Philosophie. Ich glaube, dass er schon damals die Absicht hatte, Schriftsteller zu werden. Jedenfalls schrieb er mehrere kurze Erzählungen. In einer dieser Erzählungen kam eine junge Frau mit rauen Händen vor. Ich wusste, dass Beatrix gemeint war. Eines Tages rief mich Frau Meyer telefonisch an und bat mich, Peter zu besuchen, denn es gehe ihm schlecht. Als ich bei Meyers ankam, vernahm ich, Beatrix habe sich das Leben genommen. Mutter Meyer, die robuste Ehefrau eines Handwerkers, sagte mir, sie verstehe nicht, weshalb Peter sich das Unglück von Beatrix so zu Herzen nehme; sie habe ja schon seit einiger Zeit einen anderen gehabt. Im Leben komme noch so vieles auf einen zu, da dürfe man sich nicht schon in jungen Jahren so herabziehen lassen. Sie fürchte fast, Peter wolle sich auch etwas antun; ich solle mit ihm reden. Er sass in seinem Zimmer und wirkte gefasst. Beatrix habe sich übernommen mit dem schönen Daniel, meinte er. Er schien zu denken, er hätte viel besser zu ihr gepasst, und wenn sie das akzeptiert hätte, wäre sie jetzt noch am Leben. Offenbar war Peter weniger über ihren Tod erschüttert als durch die Tatsache gekränkt, dass sie einen anderen vorgezogen hatte. So interpretierte ich die Situation und verdrängte meine eigenen Schuldgefühle.
Am nächsten Tag war ich wieder an der Uni. Ich fand mich ab mit der allwöchentlichen Folge von geisttötenden Vorlesungen und von Proseminaren, die dem Unterricht am Gymnasium ähnelten. Bald war für mich das erste Semester zu Ende. Ich brach vorzeitig ab, weil ich in die Rekrutenschule musste. Als ich nach 17 Wochen entlassen wurde, hatte das Sommersemester schon begonnen. Erst mein drittes Semester absolvierte ich von Anfang bis Ende und wohl auch ein wenig ernsthafter. Es war zugleich mein Auslandsemester.
1 Sit-in in Berlin
Schon als Gymnasiast schien mir Berlin, die sogenannte Frontstadt des freien Westens, etwas besonders Interessantes zu sein, und ich wollte unbedingt dorthin. Mein Bruder Hans-Adam wohnte seit einiger Zeit in Berlin Friedenau. Ich bat ihn brieflich, nach einem günstigen Zimmer Ausschau zu halten. Umgehend teilte er mit, ganz in der Nähe seiner Wohnung sein ein Zimmer frei geworden; dort könne ich unterkommen.
Die einstige Hauptstadt des Deutschen Reichs unterlag immer noch dem Vier-Mächte-Status, wie er am Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen worden war. Seit 1961 schied eine Mauer die drei westlichen Sektoren vom grossen sowjetischen Sektor, der das Zentrum und die östlichen Stadtteile umfasste. Westberlin war allseitig vom Staatsgebiet der DDR mit seiner scharf bewachten Grenze umgeben. Wie gestaltete sich der Alltag in einer derart abgeriegelten Stadt? Nicht nur die besondere politische Konstellation Berlins interessierte mich, sondern auch die dortige Theaterszene. Die Zeitschrift «Theater heute» stellte die Berliner Bühnen als die massgeblichen im deutschsprachigen Raum dar.
An einem sonnigen Septemberabend des Jahres 1966 bestieg ich in Frankfurt einen Zug mit vorgespannter Diesellokomotive, der nach dem Passieren der Grenze zwischen West- und Ostdeutschland mit ausgewechseltem Zugspersonal auf einem schlecht unterhaltenen Schienenstrang sehr langsam Richtung Berlin fuhr. Im Sechserabteil, in dem ich einen Platz gefunden hatte, sassen fünf sehr unterschiedliche Menschen. Vor allem erinnere ich mich an die ältere Dame, die mir direkt gegenübersass und, wie ich, in einem Buch las. Während der Grenzkontrolle – mehrere Polizisten durchstreiften das innere des Zuges, während ihre Kollegen aussen herumgingen, teilweise mit Hunden, und mit Spiegeln unter den Zug blickten – sahen wir beide auf und legten unsere Bücher beiseite. Sie lächelte mir auf sympathische Art zu. «Vous êtes Suisse?», sprach sie mich an. Ich erklärte, ich sei Student in Bern und führe nun für ein Semester nach Berlin. Sie nickte nur, fragte nicht weiter nach und erzählte ihrerseits, sie habe den über achtzigjährigen Ernest Ansermet in Genf besucht und kehre jetzt nach Warschau zurück. «Vous êtes Polonaise?», fragte ich erstaunt. Ich hatte sie für eine Französin gehalten, denn sie war sehr elegant gekleidet, mit dunkelgrünem Jupe, passender Bluse und schickem Jäckchen. An den Fingern und am linken Armgelenk glitzerte Goldschmuck. Auf meine Frage, ob sie denn auch Musikerin sei, sagte sie ein wenig kokett, sie spiele «assez bien» die Geige. Sie deutete an, dass sie in einem bekannten Orchester mitspiele, betonte aber, sie sei vor allem «professeur de Musique» und schreibe Musikkritiken, und zwar auch für westliche Publikationen. Sie gab mir ein kleines Kärtchen, auf dem Name und professioneller Titel standen, und dieses Kärtchen bewahrte ich lange Zeit auf, weil ich dachte, vielleicht würde ich irgendwann zufällig auf eine ihrer Musikkritiken stossen oder sie als Geigerin in einem Orchester entdecken. Das trat aber nie ein, und das Kärtchen ging irgendwann verloren. Mein Interesse an ihr rührte wahrscheinlich daher, dass sie in keiner Art und Weise meinen unbewussten Vorurteilen über Frauen im kommunistischen Ostblock entsprach. Sie wirkte eher aristokratisch als proletarisch, und offenbar durfte sie ungehindert ins Ausland reisen und im Ausland publizieren. Sie erzählte von diesem und jenem Musiker, von Dirigenten, die sie gut zu kennen schien, von Orchestern in Ost und West. Ich fühlte mich als kleiner Schweizer, der nicht mitreden konnte, weil er nicht einmal die zweite Landessprache richtig beherrschte und der weder von der Musik noch von Europa viel wusste. Ich hoffte, sie werde meine Unbildung nicht bemerken.
Aus meiner Pein erlöste mich der junge Mann neben mir, gross, schlank, mit braunem Teint und schwarzen Haaren. Er verstand kein Französisch und sprach Deutsch mit einem fremdländischen Akzent. Ob wir eigentlich noch in der Bundesrepublik oder schon in der DDR seien, wollte er wissen. Es war eine rhetorische Frage, denn er hatte wie wir alle bei der Grenzkontrolle seinen Pass zeigen müssen. Wir rollten jetzt über DDR-Boden, sagte ich. Da kam der Schaffner, der in einer altmodischen Reichsbahn-Uniform steckte. Barsch verlangte er die Fahrkarten. Er schien uns alle als Feinde anzusehen, besonders meinen Sitznachbarn, den er anschnauzte, weil er lange in seiner Tasche kramte, bis er sein Billett fand. Als der Schaffner ausser Hörweite war, machte ich eine Bemerkung über dessen Unfreundlichkeit. Mein Sitznachbar stimmte eifrig zu. Er halte dieses Verhalten für typisch deutsch, meinte er. Das deutsche Volk sei zwar wunderbar, habe eine grossartige kulturelle Geschichte, aber politisch sei Deutschland eine Katastrophe. In Ägypten, wo er herkomme, sei Nasser dabei, einen arabischen Sozialismus aufzubauen, und das ganze Volk stehe hinter ihm. In der DDR aber werde gegen das Volk regiert. Ulbricht werde sich nicht halten können, denn wer gegen das Volk regiere, werde früher oder später abgesetzt. Auch Erhard, der westdeutsche Bundeskanzler, habe gegen das Volk regiert und müsse deshalb die Macht abgeben. Erhard sei sicher nicht so schlimm wie Ulbricht, entgegnete ich; sein Konzept der sozialen Marktwirtschaft habe sich doch eigentlich bewährt. Marktwirtschaft sei nie sozial, meinte der Ägypter, worauf ich wissen wollte, ob Nassers Sozialismus wirklich sozial sei. In Ägypten gelte es vorerst eine Menge falscher Entwicklungen zu korrigieren, die das Erbe des Kolonialismus seien, erwiderte er spitz. Meinen Kommentar dazu schrieb ich anderntags ins Tagebuch: «Der ägyptische Student ist sehr empfindlich gegen alle sozialen Missstände in Europa; die Missstände im eigenen Land sieht er nicht. Er operiert mit Schlagworten und malt schwarz-weiss. Ich glaube, das ist typisch für Menschen aus Entwicklungsländern.» – Wie kam ich dazu, frage ich mich heute, eine solche Bemerkung zu machen, obwohl ich bis dahin nicht die geringste Erfahrung mit Menschen aus Entwicklungsländern gehabt hätte? Man könnte die Sache umkehren: Mein Eintrag im Tagebuch war typisch für einen Schweizer, der voller Vorurteile steckte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Was war, ist wahr»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Was war, ist wahr» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Was war, ist wahr» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.