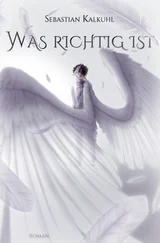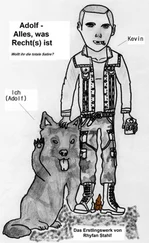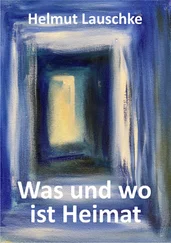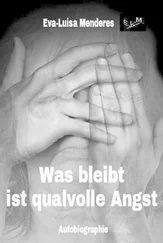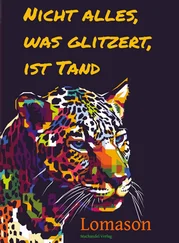Im September 1965 ging meine Schulzeit zu Ende. Mit einer Ausnahme bestanden alle Absolventinnen und Absolventen des deutschsprachigen Gymnasiums die Maturitätsprüfung. Es folgte ein feierlicher Akt im grossen Saal des Farelhauses. Rektor Hans Utz händigte uns in alphabetischer Reihenfolge die Zeugnisse aus. Lobend erwähnte er Lilly Spring, die in allen Fächern Bestnoten erzielt hatte. Mein Zeugnis war gut, aber nicht sehr gut. Jedenfalls eröffnete es mir die Möglichkeit, jede beliebige Studienrichtung einzuschlagen. Der Rektor verlas eine Liste mit den Angaben, die wir zu unseren Studien- und Berufsabsichten hatten machen müssen. Ich hatte angegeben, ich wolle Astronomie studieren. Das war ein wenig aus der Luft gegriffen, aber es klang interessant.
Es war Tradition, dass an den Maturitätsfeiern eine bekannte Persönlichkeit eine Rede hielt. Unser Festredner war Arnold Kübler, der Gründer und Redaktor der Kulturzeitschrift «DU», bekannt auch als Verfasser der «Öppi»-Romane. Er war klein und hatte ein seltsam entstelltes Gesicht, und doch vermochte er uns vom ersten Moment an für sich einzunehmen. In jungen Jahren war er Schauspieler gewesen, hatte auf die Theaterschminke allergisch reagiert, worauf ihm ein Arzt die Furunkel mit dem Skalpell aufgeschnitten und die Wunden danach ungenügend versorgt hatte. Die Narben zogen die Haut zusammen und liessen tiefe Gräben entstehen, die sich, während er redete, lustig in die Länge und in die Breite verzogen. Ich lauschte seinen Worten und war mit allem, was er sagte, vollkommen einverstanden. Wir sollten uns nicht fragen, meinte er, welches Studium uns später ein hohes Einkommen ermögliche; vielmehr sollten wir herausfinden, auf welchem Weg wir zu dem gelangen konnten, was uns wirklich am Herzen liege, denn nur so könnten wir unser Glück finden.
Die Astronomie war also ein Luftgespinst, und im Grunde genommen wusste ich, dass ich Phil. I studieren wollte, vorzugsweise Deutsch und Geschichte, denn im Studium der Sprache und der Literatur und in der Aneignung der Vergangenheit hoffte ich der Wahrheit und dem guten Leben auf die Spur zu kommen. Ich wollte aber nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich bloss aus Trotz gegen Papa, der ein derartiges Studium als eine Form von Hochstapelei ansah, so entschied. Deshalb zögerte ich meinen Entscheid hinaus, tat so, als ob ich nicht wüsste, was ich wollte. Mama schickte mich zu einem Berufsberater. Der befragte mich eingehend und empfahl mir das Jus-Studium, was nicht ganz abwegig war, denn mein Grossvater mütterlicherseits war Notar gewesen. Ich diskutierte darüber mit Christoph, dem ältesten Sohn von Mamas Freundin Marianne Steinlin, der ein begeisterter Jus-Student war. Alles spreche für diese Studienrichtung, sagte er, denn das Zusammenleben in einer Gesellschaft setze voraus, dass es Regeln gebe, an die sich alle halten müssten, was aber nur möglich sei, wenn diese Regeln im Konfliktfall von Fachleuten, den Juristen, interpretiert und nach Bedarf weiterentwickelt würden. Dagegen setzte ich die Meinung, wir Menschen brauchten weniger Vorschriften und mehr Freiheit, denn nur so könne sich unsere Kreativität, unser Drang nach Wahrheit und unser Wille, Gutes zu tun, voll entwickeln.
Mein Wunsch stand fest, und Mama wusste es. Aber würde Papa einwilligen? Würde er mir ein Studium bezahlen, das er missbilligte? In den Wochen bis zum Semesterbeginn an der Uni Bern vermied ich die Auseinandersetzung mit ihm. Wahrscheinlich hatte es ihm Mama verraten, aber er sagte nichts. Ich lenkte mich ab mit Spielereien. Immer noch lockte es mich, einen Film zu machen. Ich fragte Jürg Spiess, der eine Super-8-Kamera besass, ob er mithelfen würde. Er sagte zu. Es war ein Non-sense-Film mit dem Titel «Il protagonista». Peter Meyer spielte die Hauptrolle, Jean-Pierre Wolf sorgte für die Slap-stick-Einlagen, Jürg bediente die Kamera, ich führte Regie. Eigentlich tat ich nur so als ob; der Film bestand weitgehend aus Improvisationen. Peter Meyer besorgte den Schnitt und war sehr stolz auf das Ergebnis, das wir an einer Kunstvernissage in der Galerie von Silvia Steiner vorführten. Weil das Filmmaterial alt und verdorben war, hatten die Bilder einen Grünstich. Wir behaupteten, wir hätten mit chemischen Substanzen gearbeitet, um einen Verfremdungseffekt zu erzielen. Im «Bieler Tagblatt» erhielten wir eine wohlwollende Kritik, in der das Experiment mit der grünlichen Verfärbung speziell lobend erwähnt wurde. Als Peter später unter dem Namen E. Y. Meyer als Schriftsteller bekannt wurde, besass er den Film immer noch und zeigte ihn während einer seiner Lesungen im «Zähringer» in Bern.
Wie gesagt, der Film war eine Spielerei, eine Ablenkung. Doch mir schien, ich sollte, bevor ich mein Universitätsstudium begann, mehr Klarheit darüber gewinnen, was meinen «Drang nach Wahrheit» ausmachte. Eigentlich hatte ich doch die klassischen Bildungsideale längst über Bord geworfen; das Gute, das Wahre und das Schöne waren mir verdächtig. Ich glaubte nur noch an das Nützliche. Und doch steckte der Idealismus tief in mir, und dem wollte ich auf die Spur kommen. Ich las Platons «Apologie», die grosse Verteidigungsrede des Sokrates vor dem athenischen Volksgericht. Er war angeklagt, ein Verderber der Jugend zu sein und die vom Staat angenommenen Götter abzulehnen. Dies entspreche nicht der Wahrheit, sagte Sokrates zu seinen Richtern, und er wolle der Unwahrheit der Anklage die schlichte Wahrheit entgegensetzen. Er sei kein Weiser, sondern ein Fragender, und er wisse wohl, dass er die Menschen, die er untersuche und bei denen er sehr wenig Wissen gefunden habe, verärgert und sich dadurch viele Feinde gemacht habe. Aber es sei nun mal seine Aufgabe, nach der Wahrheit zu suchen, und es sei eine wichtige Aufgabe. Dass er damit die Jugend verderbe, sei eine blosse Behauptung. Auch dazu wolle er die Wahrheit herausfinden. Das nun folgende Frage- und Antwortspiel zwischen Sokrates und seinem Ankläger Melitos gibt Platon so wieder: Wer ist es denn, der die Jugend besser macht, statt sie zu verderben, fragt Sokrates. Die Richter sind es, sagt Melitos. Alle oder nur einige, will Sokrates wissen. Alle, sagt Melitos, und ausserdem auch die Männer des Rates und letztlich alle Athener. Alle Athener also machen sie gut und edel, nur er, Sokrates verdirbt sie? Melitos bestätigt es. Sokrates konstatiert: Bestens steht es um die Jugend, wenn einer allein sie verdirbt, die andern alle aber sie zum Guten fördern. Er will nun wissen, in welcher Art er die Jugend verdirbt. Statt Melitos antworten zu lassen, gibt er selbst die Antwort: Offenbar indem ich lehre, nicht an die Götter zu glauben, sondern an allerlei Neues, Daimonisches. Ja, sagt Melitos, du glaubst nicht an die Götter. Sokrates widerspricht: Der Daimon selbst ist göttlich oder stammt zumindest von Göttern ab. Also kann ich nicht ganz gottlos sein.
Der Dialog, wie ihn Platon aufgeschrieben hat, kam mir konstruiert vor. Überzeugend daran schien mir nur, dass Sokrates sagt, er sei nicht im Besitz der Wahrheit, er suche aber danach, und das allein sei wertvoll. Doch ist es echte Wahrheitssuche, wenn Sokrates immerfort Suggestivfragen stellt und die Antworten bekommt, die er will, die seiner Argumentation dienen? Hätten nicht seine Gegner vielleicht genauso gute Argumente? Man kann alles immer von unterschiedlichen Seiten her betrachten, dachte ich, und deshalb gibt es unterschiedliche Wahrheiten.
Noch problematischer als sein Wahrheitsbegriff kam mir Sokrates’ Daimon vor. Er schildert ihn als etwas Göttliches, das uns mahnt, bei der Wahrheit zu bleiben. Bei welcher Wahrheit? Sokrates’ Daimon war für mich nichts anderes als das, was wir das Gewissen nennen, und das Gewissen bildet sich durch Erziehung und gesellschaftliche Zwänge. Nur daran glaubte ich, nicht aber an eine göttliche Stimme, die uns leitet. Seit meinem 16. Lebensjahr wollte ich ein Naturalist sein, das heisst, ich sah meine Erkenntnismöglichkeit auf Natur und Gesellschaft beschränkt, glaubte an nichts Übernatürliches, verzichtete auf Gott. Was ich im Biologie-Unterricht über den Darwinismus gehört hatte, genügte mir: Es geht ums Leben und Überleben, um den Kampf ums Dasein. Wer sich den Verhältnissen anpasst, überlebt, wer dazu nicht imstande ist, geht unter. So war ich nicht nur Naturalist, sondern auch Sozialdarwinist. Die Erkenntnisse der Verhaltensforscher Bernhard Grzimek und Konrad Lorentz übertrug ich von den Tieren auf die Menschen. Diese verstand ich besser, wenn ich das Verhalten jener verstand. Damit war ich weit entfernt von Sokrates und von der Ideenlehre Platons.
Читать дальше