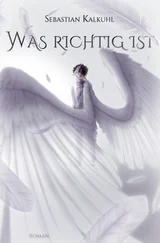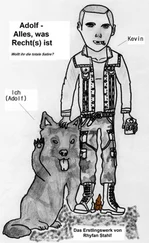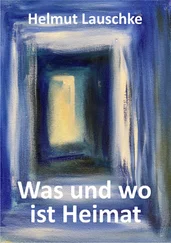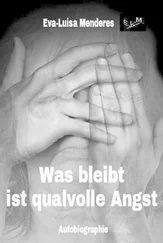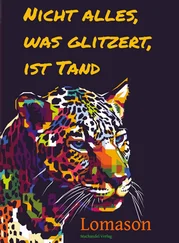Der Dialog steht nicht so in meinem Tagebuch; das Thema, über das wir sprachen, ist nur kurz angedeutet. Ich habe eine Rekonstruktion versucht und möglicherweise das Original verfehlt. Sicher ist aber, dass wir über Gott nachdachten. Ob lenkend oder nicht, er war uns längst nicht mehr selbstverständlich. Umso wichtiger fand ich es, die Probleme ernst zu nehmen, die uns Hochhuth so eindringlich vorführte. Das abgrundtief Böse, das mit der Naziherrschaft in die Welt gekommen war, schien mir das Wichtigste in der ganzen Geschichte seit den Anfängen der Menschheit zu sein, etwas, das wir nie vergessen durften. Wenn der Zweck der gymnasialen Bildung war, uns zum Guten, Schönen und Wahren hinzuführen, dann mussten wir uns auch der Gefahr des Bösen, Hässlichen und Unwahren bewusst werden. Unsere Lehrerinnen und Lehrer vermittelten uns eine Haltung, wonach Demokratie gut und Rassenwahn schlecht war. So etwas wie die Diktatur Hitlers dürfe es nie mehr geben, meinten sie. Bevor ich Hochhuths Stück gesehen hatte, war ich überzeugt gewesen, so etwas könne es nie mehr geben, denn wir lebten in einer zivilisierten, geordneten Welt, in der das Leben jedes Menschen geachtet wurde und in dem man sich keinesfalls von einem brüllenden politischen Führer verhetzen liess. Hochhuths Stück führte mir vor Augen, wie schwierig es unter Umständen war, das Überhandnehmen des Bösen zu verhindern.
In der gleichen Zeit, in der wir uns mit Hochhuth befassten, bereiteten wir unter Schafroths Anleitung die Aufführung des Brecht-Stücks «Furcht und Elend des Dritten Reiches» vor. Darin geht es um die Veränderungen im deutschen Alltag seit der Machtergreifung der Nazis. Im Théâtre de Poche spielten wir grobe SA-Leute, ängstliche Richter, verwirrte Schulmänner, zynische SS-Offiziere, anpasserische Hausfrauen, irregeleitete Kinder. Nur eine Rolle kam im Stück nicht vor: die des heldenhaften Widerstandskämpfers. Ich übernahm die Rolle eines SA-Schlägers und eines SS-Offiziers und spürte, wie verführerisch die Hingabe an den Hass und die Ausübung rücksichtsloser Macht sein können.
Das Theater faszinierte mich. Es war eine Möglichkeit, die eigene Welt zu erweitern. Ich erinnere mich an das Gefühl, das mich ergriff, als ich im Théâtre de Poche erstmals auf der Bühne stand. Wir hatten die Brecht-Texte zuerst für uns allein auswendig gelernt und dann im Schulzimmer wechselweise gesprochen. Jetzt also Bühnenprobe. Während des Wartens auf unseren Regisseur waren wir nicht untätig. Schnellen Schrittes gingen wir auf der Bühne hin und her und rund herum, und dabei kam mir das geflügelte Wort von den «Brettern, die die Welt bedeuten» in den Sinn, ohne zu wissen, dass es aus Schillers Gedicht «An die Freunde» stammt. Dort heisst es: «Sehn wir doch das Grosse aller Zeiten / Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, / Sinnvoll still an uns vorübergehn.» Schiller, der Historiker, Theaterautor und Schauspieltheoretiker erfasste mit seinen Versen die Sicht des Zuschauers im Theater oder des Beobachters der Weltgeschichte. Beim Herumgehen auf der Bühne empfand ich indessen etwas anderes, nämlich die Möglichkeit, selbst tätig zu werden, selbst etwas darzustellen, selbst die Welt zu gestalten. Das Theater packte mich. «Furcht und Elend des Dritten Reichs» war nur ein Anfang.
Am Premierenabend standen am Eingang zum Theaterkeller Mitglieder der Organisation der Kommunisten der Schweiz (OKS) und verteilten Flugblätter, auf denen sie dem Publikum nicht viel mehr mitteilten als die bekannte Tatsache, dass Brecht ein Kommunist gewesen sei. Ich empfand die Flugblattaktion als Versuch, unsere Aufführung den Zielen des Kommunismus nutzbar zu machen. «In unserer ‘jugendlichen Unschuld’ hatten wir bei unserer Aufführung nicht an Politik gedacht», notierte ich im Tagebuch. Unser Deutschlehrer und Regisseur verbot den jungen Kommunisten, bei der nächsten Aufführung ihre Flugblätter noch einmal zu verteilen. Sie kamen wieder. Schafroth forderte uns auf, sie zu packen und in den Brunnen gleich gegenüber dem Eingang zum Kellertheater zu werfen. Auf dem Brunnenstock aus dem 16. Jahrhundert war sinnigerweise ein sitzender Engel zu sehen, der ein unschuldiges Lämmchen in den Armen hält und vor dem Zugriff des dahinterstehenden roten Teufels schützt. Die meisten von uns ignorierten Schafroths Aufforderung, aber ein paar besonders eifrige Mitschüler jagten in langen Sprüngen die Kellertreppe empor, ergriffen einen der Flugblattverteiler und warfen ihn in den Brunnentrog. Das fand ich etwas kindisch und nicht sehr überlegt, aber auch nicht allzu schlimm. Schafroth bekam in den folgenden Tagen mehrere Telegramme, Briefe und Telefonanrufe von empörten Linken. Konrad Aeschbacher schrieb ihm: «Gratuliere zum sichtlichen Erfolg deiner Brecht-Interpretation. Im Nazi-Deutschland begann der Gesinnungsterror auch mit Keilereien. Sieg Heil!» Das war stark, und als ich es vernahm, wurde mir ein wenig unbehaglich. Jean-Pierre Wolf, der schon vorher empört gewesen war über die Brunnen-Aktion, stellte sich vor der nächsten Aufführung auf eine Bank in der Garderobe und hielt eine Ansprache: Wir sollten alle zugeben, dass wir aus einem emotionalen Antikommunismus heraus gehandelt hätten. Die Leute hätten das Recht gehabt, Flugblätter zu verteilen. Man dürfe ihnen diese Freiheit nicht nehmen. Ich rief ihm zu, ob er denn meine, dass diejenigen, deren erklärtes Ziel es sei, die bestehende Ordnung zu zerstören, den Schutz dieser Ordnung für sich in Anspruch nehmen könnten. Er ignorierte den Einwand. Da griffen ihn Jürg Spiess und Max Benguerel mit heftigen Worten an. Er sei ein Demagoge und versuche, den Widerstand gegen den Kommunismus zu untergraben. Er gab zurück: Sie seien Rechtsextremisten. «Es gibt Regeln, die man einhalten muss, und die Kommunisten halten sich nicht daran», sagte Jürg. «Nein, nein», rief Hans Renfer, «die bestehende Ordnung kann ich auch nicht einfach so akzeptieren. Ich muss festhalten, dass es mit unserer Verwaltung schlecht bestellt ist. Allzu vieles ist faul in unserem Staat; eine Änderung von Grund auf tut not.» Einige stimmten zu, andere verwahrten sich gegen solche Ansichten. Es wurde immer lauter in der Garderobe, die Argumente verwirrten sich und etwas Unheimliches brach sich Bahn, eine triebhafte Lust, auf dem Gewohnten, dem Ordentlichen und dem Schicklichen herumzutrampeln, sich zu gebärden, als stünde eine Revolution unmittelbar bevor. Ich erschrak und mochte mich weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen.
Der dickliche junge Flugblattverteiler war mir, als ihn meine Schulkameraden gepackt und in den Brunnen geworfen hatten, hilflos und ängstlich vorgekommen. Er hatte mir leidgetan, denn er hatte etwas Gutes tun wollen, und wurde von uns als Feind behandelt. Andererseits fand ich, der Kommunismus sei eine üble Sache, auf die man sich keinesfalls einlassen dürfe. Doch worauf stützte sich diese Auffassung? Noch hatte ich mich nie ernsthaft mit den Grundlagen des Kommunismus auseinandergesetzt. Im Wesentlichen glaubte ich, was ich in den bürgerlichen Zeitungen las, im Radio hörte, von unseren Lehrern vernahm. Unreif war ich und keineswegs reif oder maturus , obwohl ich in Kürze das Gymnasium mit der Maturitätsprüfung abschliessen sollte.
1 Romantik und Realismus
Der Schulabgang, stellte ich mir vor, würde die grosse Befreiung sein. In den Sommerferien schrieb ich das Drehbuch zu einem Film, mit dem Titel «Le club du savoir vivre». Darin ging es um die durch Liebesdinge entfesselten Gefühle und Gedanken, die nach Verwirklichung drängten. In Beatrix hatte ich mich verliebt. Als sie mich in Magglingen besuchte, waren wir nahe daran, miteinander zu schlafen. Wir taten es nicht. Ob sie es wollte, wie gross ihre Hemmungen waren, weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass ich plötzlich unsicher wurde, ob ich sie wirklich liebe, denn die Liebe zu einer Frau hielt ich für etwas sehr Grosses, Wichtiges, Absolutes, es musste alles stimmen, um sich ganz der Liebe hingeben zu können.
Читать дальше