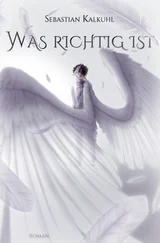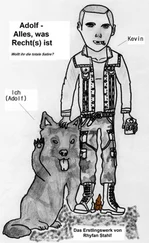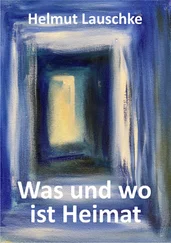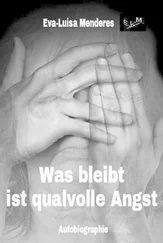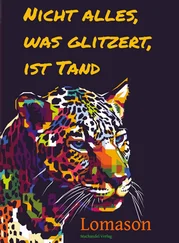Was ich aus meinem Leben erzähle, ist sowohl individuell als auch allgemein, sowohl persönlich-privat als auch Teil der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Meine Lebensgeschichte enthält familiär bedingte Züge und ist doch vor allem zeitbedingt; sie ist typisch für einen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen und in günstigen Umständen aufgewachsenen Schweizer, der die Spannung zwischen der eigenen Privilegiertheit und der Armut und Not anderer Menschen spürt.
Das Böse liegt hinter uns – und wo bleibt das Gute?
1 Landleben und Leben in der Stadt
Ich war ein Nachkriegskind, doch die Zeit des Zweiten Weltkriegs reichte bis in meine Kinderzeit hinein, denn die Güterknappheit hielt noch eine Weil an. Die Lebensweise, die sich meine Eltern in den Kriegsjahren angewöhnt hatten, konnten sie nicht so rasch abstreifen. Das wusste ich damals noch nicht, denn so wie es war, war es für mich selbstverständlich: Wenn es sehr kalt war, genügte die Kohleheizung in unserer Wohnung nicht. Mama legte mir einen Seelenwärmer um die Brust, eine Art Gilet aus Wolle, und zog mir einen engen Pullover über den Kopf, so dass ich mich wie in eine Rüstung eingezwängt fühlte, denn die mit feiner Holzwolle gestreckte «Kriegswolle» machte das Kleidungsstück hart wie ein Brett. Wir assen einfache Mahlzeiten, Brot mit wenig Butter und selbstgemachter Konfitüre, Hafer- und Griessbrei, Apfelkompott, Kartoffeln, Hörnli, Gemüse, Suppe, ab und zu ein wenig Fleisch. Es war die Fortsetzung der Knappheit, wie sie in den Kriegsjahren geherrscht hatte. Die Schränke meiner Mutter waren voll von Einmachgläsern, beiseitegelegtem Silberpapier, Packpapier und gebrauchten Schnüren. Nichts, was noch brauchbar war, wurde weggeworfen. Im Hinterhof stand das Velo des Nachbarn, dessen Räder mit an die Felgen gebundenen Korkzapfen versehen waren. Es erinnerte daran, dass die Luftreifen aus Gummi während des Krieges kaum noch erhältlich oder sehr teuer gewesen waren.
Unausgesprochen lasteten schwierige Erlebnisse meiner Eltern auf unserem Familienleben. Es gab einen sechs Jahre älteren Bruder, der einen anderen Nachnamen hatte als ich. Mit ihrem ersten Mann hatte meine Mutter in Ägypten gelebt und war 1940 als Witwe mit dem eben erst zur Welt gekommenen Hans-Adam in die Schweiz zurückgekehrt. Hier heiratete sie meinen Vater; er war schon über 40 Jahre alt. Vor dem Krieg hatte er in Frankreich gearbeitet, dann nach Ausbruch des Krieges im engen Kandertal im Berner Oberland, wo er eine Kohlegrube leitete. Hilde zog mit Hans-Adam zu ihm, gebar ihm eine Tochter, meine Schwester Elisabeth. Unmittelbar nach Kriegsende zogen sie zu viert nach Biel, wo ich ein Jahr später geboren wurde.
Meine Mutter war promovierte Philologin, hatte aber nach eigenem Bekunden nichts dagegen, sich auf die Rolle als Hausfrau und Mutter zu beschränken. Sie kochte sparsam, achtete aber darauf, dass wir drei Kinder gesundes Essen bekamen. Allmählich wurde der Speiseplan vielfältiger. Eine wichtige Neuerung war die Joghurtmaschine. Den dünnen, sauren Joghurt assen wir mit Rohzucker oder mit Melasse gesüsst. Wir mussten Rüblisaft trinken, und im Winter jeden Morgen einen Löffel Lebertran herunterwürgen.
Wir wohnten am Schüssquai in einem soliden Haus im dritten Stock. Vor dem Haus war eine Strasse mit wenig Verkehr, die dem Schüsskanal entlangführte. Dort spielten wir mit dem Gummiball, warfen ihn hoch in die Luft und riefen «Uri» oder « Schwyz» oder «Unterwalden» oder «Luzern» oder «Zürich» oder «Bern» ... Jedes Kind war ein Kanton, und wenn sein Kantonsname aufgerufen wurde, musste es den Ball auffangen. Manchmal flog er über das gusseiserne Geländer in den Kanal und schwamm davon. Wir rannten hinterher, und die Schnellsten und Mutigsten kletterten die Ufermauer hinunter und fischten ihn heraus. Wir waren eine kleine Kinderbande; Kurt war unser Anführer. Er war sechs Jahre älter als ich und gab den Ton an. «Locker laufen», befahl er, und sogleich rannten wir mit hängenden und schlenkernden Armen herum. Oder er band uns an eine Wäscheleine und unternahm mit uns Klettertouren beim Pavillon Felseneck.
Mein Grossvater, Notar Werner Wyss, kaufte 1949 ein Ferienhäuschen in Magglingen, liess es im Grundbuch auf den Namen meiner Mutter eintragen. Wenige Jahre danach starb er. Das Häuschen war das Geschenk an uns; dort verbrachten wir die ganze Sommerzeit und viele Wochenenden. Heute wohne ich zusammen mit meiner Frau Annemarie in diesem inzwischen renovierten und erweiterten Haus. Wir haben zudem eine kleine Wohnung in Biel. Diese komfortable Wohnsituation entspricht dem Muster aus meiner Kindheit, das einerseits von den Erfahrungen der ländlichen Sommerfrische auf dem Berg, andererseits vom Leben unten in der Stadt geprägt war.
Es ist eine weit entfernte Zeit, und was wir erlebten und in uns aufnahmen, unterscheidet sich in manchem stark von dem, was heute unsere Enkelkinder erleben und wie sie spielen, denn sie sind beeinflusst von einer virtuellen Welt, die via Handys und Computer auf sie eindringt. Andererseits ist vieles auch gleichgeblieben. Oft staune ich darüber, wie kleine Kinder sich in ihrem kindlich-spontanen Wesen ähnlich sind und mich an meine eigene Kindheit erinnern.
Die Einschränkungen der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit gerieten allmählich in Vergessenheit. Papa verdiente mehr Geld und erhöhte das Haushaltgeld für Mama, so dass sie einen neuen Staubsauger und eine kleine Waschmaschine anschaffen konnte. Den grossen, holzbefeuerten Kessel in der Waschküche benutzte sie nicht mehr; der elektrisch angetriebene Hoover wirbelte die Wäsche automatisch herum, bis sie sauber war. Der Ofen in der Küche musste nicht mehr mit Holz vorgeheizt werden; es gab jetzt eine Gasfackel, welche die darüber geschichtete Kohle anzündete.
Die grosse Veränderung kam im Jahr 1956. Wir verliessen das Plänke-Quartier und zogen ins Madretsch-Quartier. Die Wohnung in einem neuen Mehrfamilienhaus war grösser, und das Haus hatte eine zentrale Ölheizung. Ein Radio mit eingebautem Plattenspieler stand neuerdings neben dem Esstisch. Einen Fernseher gab es nicht; dieses Wunderding konnte ich nur ab und zu im Nachbarhaus bei meinem Freund Röbi Nordmann geniessen.
1956 war der Aufstand in Ungarn, der von sowjetischen Truppen niedergeschlagen wurde. Ich war zehn Jahre alt. Meine Eltern machten ein ernstes Gesicht und versuchten, die schlimmen Nachrichten von uns fernzuhalten. Das erwies sich als unmöglich, weil überall darüber gesprochen wurde. Wir stellten in der Schule kleine Fähnchen in den ungarischen Farben her und verkauften sie. Der Erlös kam der Ungarnhilfe zugute. Es wurde eine Schweigeminute zum Gedenken an die mutigen Kämpfer für die Freiheit angekündigt. Meine Mutter nahm mich mit auf die Strasse, damit ich sehen konnte, was Solidarität bedeutet. Tatsächlich standen zum festgelegten Zeitpunkt alle Passanten auf den Trottoirs still und alle Fahrzeuge auf den Strassen hielten an. Vom Kirchturm läuteten die Glocken; es war ein feierlicher Moment. Da knatterte ein klappriger Kleinlastwagen heran. Ich winkte dem Fahrer zu, bedeutete ihm anzuhalten. Er tat es, und ich kam mir ein wenig als Freiheitsheld vor. Von nun an wusste ich, dass es einen freien Westen gab, zu dem die Schweiz gehörte, und einen unterdrückten Osten, zu dem das unglückliche Ungarn gehörte. So blinzelte ich über die bisherige Begrenzung hinaus und fühlte mich umso geborgener in meiner Heimat.
Meine Kindheit und Jugend war voller Hingabe – an die eigenen Gefühle, an die Liebe zu den Eltern und zu den Geschwistern, an die Schönheit der Welt, an den Kummer über Missgeschicke, später auch die an die pubertäre Auflehnung gegen den Vater und gleichzeitig an das drängende Gefühl der erwachenden Libido. Nach und nach empfand ich eine zunehmende Distanz gegenüber der Welt. Oft war ich unglücklich, schwankte zwischen Unsicherheit und Überheblichkeit, gewöhnte mir einen gewissen Zynismus an. Das war wohl eine Reaktion darauf, dass ich von meinem Vater oft in kränkender Art zurechtgewiesen wurde. So kam es mir jedenfalls vor, und eine besonders krasse Zurechtweisung ist mir im Gedächtnis geblieben. Es geschah, als Papa, Mama, meine beiden Geschwister und ich nach Luzern fuhren, um das neu eröffnete Verkehrshaus der Schweiz zu besuchen. Ich war 13 Jahre alt und voller Tatendrang. Als der Zug langsam in den Bahnhof Luzern einfuhr, öffnete ich die Waggontür, und noch bevor der Wagen stillstand, sprang ich auf den Perron. Wollte ich mir meine sportlichen Fähigkeiten beweisen, oder geschah es aus blosser Freude an der Bewegung oder aus Vorfreude auf das Verkehrshaus? Jedenfalls tat ich damit etwas Verbotenes. Papa bemerkte es, stieg mit verzerrtem Gesicht aus dem Zug, stürzte auf mich zu und knallte mir seinen Spazierstock auf den Hintern. Nicht genug damit, er eilte danach zum Kondukteur und rief ihm zu: Zeigen Sie diesen Jungen an, er ist vom Zug gesprungen! Der Kondukteur war ein wenig verwirrt und stotterte etwas von «nicht erlaubt», ohne die Sache allzu ernst zu nehmen. Mama versuchte zu beschwichtigen, was Papa nur noch mehr aufbrachte. Bruder und Schwester schauten beiseite, weil ihnen Papas Auftritt vor all den vorbeiströmenden Passagieren peinlich war. Ich war gedemütigt und voller Hass.
Читать дальше