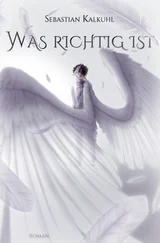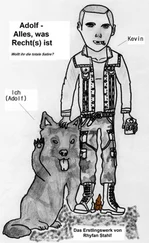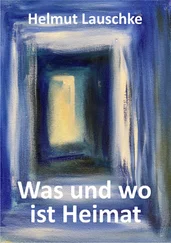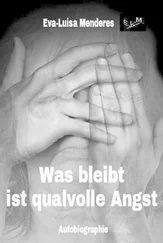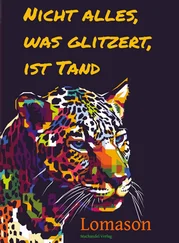Allerdings war mein Denken wenig gefestigt. Auch später noch, als ich im Marxismus Halt zu finden glaubte, schwankte ich hin und her zwischen dem Glauben an die Wirkung von etwas Transzendentem auf uns Menschen und dem puren Naturalismus, zwischen Idealismus und Materialismus. Und damals, als ich die Apologie des Sokrates las, war ich trotz aller Skepsis versucht, auch eine andere Lesart zuzulassen. Die Künstlichkeit des Dialogs verstand ich dann nicht als Fehler des Sokrates, sondern sah dahinter den eigentlichen Autor, nämlich Platon, der etwas demonstrieren will. Und auch der Daimon kam mir nicht ganz so abwegig vor, wenn ich ihn als göttliche Mahnung verstand, nicht von der Wahrheit abzuweichen. Denn das Wahre und das Gute gehören zusammen. Beides lässt sich nicht vom Nützlichen ableiten oder als Leitlinie für nützliches Verhalten zurechtbiegen; sie sind absolut. Dem Wahren und Guten ist das Schöne beigesellt, dem sich, wie Schiller in der Nänie» sagt, Menschen und Götter unterwerfen sollten.
1 Die lieben Bücher
Kurz vor dem Beginn meines ersten Studiensemesters standen mir zwei unterschiedliche Existenzweisen deutlich vor Augen: «Wie die Ameise getrieben vom Naturgesetz ein Leben lang emsig arbeitet, kann auch der Mensch ins Leben eintauchen, entweder ohne zu wissen, dass er gar nicht frei ist, oder in einsichtiger Unterwerfung unter das Naturgesetz. Die andere Möglichkeit ist, dass er nicht eintaucht, sondern darüber schwebt und Erkenntnisse gewinnt.» Mich lockte die zweite Möglichkeit. Warum? Weil ich mich daran erinnerte, dass ich, als ich etwa 16 Jahre alt war, das Gefühl hatte, endlich zu erwachen. Mir schien, ich erkenne nun meine Umwelt, es werde mir bewusst, was menschliches Leben ist, wie der Mensch in der Welt steht, durch welche Kräfte die Gesellschaft zusammengehalten wird. Mir schien, alles hänge mit allem zusammen, und diese Einsicht machte mich glücklich. In der Schule aber erlebte ich das Gegenteil: Alles wurde zerteilt, jedes Fach stand für sich, das Dazwischenliegende blieb dunkel. Als Gymnasiast musste ich mich behaupten, die Lehrer und Lehrerinnen benoteten unsere Leistung, und die Noten gaben an, ob ich besser oder schlechter als die anderen war. Das Glücksgefühl, das aus der Erkenntnis der Zusammenhänge und aus dem Erleben des Gemeinsamen erwächst, wurde durch den öden Schulalltag verdrängt. Jetzt, da die Schulzeit zu Ende war, wollte ich es zurückholen.
Ich beschloss, keine Karriere im Sinn von materiellem Gewinn anzustreben, sondern mich auf den Weg zunehmender Erkenntnis zu begeben. Allerdings musste ich selbstkritisch feststellen, dass meine Möglichkeiten begrenzt waren, denn oft war ich zu faul, eine Sache zu Ende zu denken, oder auch einfach unfähig dazu. So tröstete ich mich damit, dass man sowieso nie endgültige Antworten finden könne. «Je weiter man sieht, desto komplizierter wird alles. Man sollte sich trotzdem immer anstrengen», notierte ich und versuchte mich so für ein intensives Studium zu motivieren. Denn ich wollte nicht wie Goethes Faust am Ende sagen müssen: «Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!» Nein, ich gedachte, klüger zu werden, und meinte, wenn ich nur wolle, würde mir das auch gelingen. So wurde ich ein Büchernarr. Das Bücherlesen ist aber eine einsame Angelegenheit, und die andere Komponente des Glücks, die Gemeinsamkeit, litt darunter.
Das ganze Wissen war in den Büchern, glaubte ich, und diese waren dank der Erfindung des Taschenbuchs wohlfeil zu haben. Zeitweise arbeitete ich in der Taschenbuchhandlung Lüthi. Die Filialleiterin, Fräulein Mohr, hatte eine Aushilfe gesucht; Peter Meyer hatte sich gemeldet und den Job bekommen. Als er einen besseren fand, schlug er mich als seinen Nachfolger vor. Die Buchhandlung war mir von meinen häufigen Besuchen her vertraut. Immer wieder hatte es mich hingezogen zu den rororo -, dtv - und Fischer-Taschenbüchern, den Reclam -Bändchen, den englischen Penguin Books , den französischen Que sais-je? und den Livres de Poche . In einem nicht besonders grossen Raum im Erdgeschoss eines modernen Gebäudes waren sie untergebracht, ringsum von grossen Glasscheiben umgeben, so dass der Raum hell und aufklärend wirkte. Auf niedrigen Gestellen standen gut greifbar die Objekte meiner Begierde. Jetzt durfte ich also als Verkäufer statt als Kunde mit ihnen umgehen. Als ich eintrat, um mich dem blonden Fräulein Mohr als Nachfolger von Peter zu präsentieren, war sie gerade dabei, die bunten Bändchen der edition suhrkamp zu tätscheln, wie sie sagte, damit sie wieder in eine gerade Reihe zu stehen kamen. Wo zwischen ihnen eine Lücke klaffte, holte sie aus der Schublade unterhalb des Büchergestells Ersatzbändchen hervor und ordnete sie an der richtigen Stelle ein. Die Umschläge waren so nummeriert und gefärbt, dass sie, wenn die einzelnen Bändchen vollständig und fortlaufend eingeordnet waren, die Farbabfolge des Regenbogens ergaben. Das sah hübsch aus, und darauf legte Fräulein Mohr grossen Wert. Auf weitere Instruktionen verzichtete sie, bat mich einfach, allfällige Kunden zu bedienen, derweil sie kurz ins Lager im ersten Stock hinaufgehe. Ein erster Kunde trat ein. Es war ein Gymnasiast, der nach den Gedichten von Walther von der Vogelweide fragte. Ich hatte keine Mühe, das Büchlein aus der Reihe «Exempla classica» im Fischer Verlag zu finden. Der Schüler bezahlte mit einer Zehnernote. Der Preis von 4 Franken 35 Rappen war auf der Innenseite des Buchdeckels mit Bleistift angeschrieben, und diesen Betrag tippte ich in die Kasse ein, aber die Schublade mit dem Wechselgeld öffnete sich nicht. Fräulein Mohr hörte meine Hilferufe nicht, so dass ich 5 Franken und 65 Rappen aus meinem eigenen Portemonnaie hervorklauben und dem Kunden aushändigen musste. Als Fräulein Mohr endlich wieder ins Verkaufslokal trat und ich ihr das Problem schilderte, entschuldigte sie sich für das Versäumnis und erklärte mir die genaue Funktionsweise der Kasse. Zudem wies sie mich an, jedes verkaufte Buch in eine Verkaufsliste einzutragen, damit sie es nachbestellen könne. Das alles war nicht schwierig, und die Zahl der Kundinnen und Kunden hielt sich in Grenzen, so dass ich genug Zeit hatte, zwischendurch irgendein Büchlein aus einem Gestell zu ziehen und darin zu lesen. Wenn ich es wieder einordnete, tätschelte ich die Buchrücken, bis alle wieder genau auf der gleichen Linie standen.
Eines Tages trat Beatrix in die Buchhandlung. Überschwänglich begrüsste sie mich. Sie habe gehört, dass ich hier arbeite. Was sie denn für ein Buch haben möchte, fragte ich. Sie sei nicht wegen der Bücher gekommen, sondern wegen mir, sagte sie. Jetzt wurde mir ein wenig unbehaglich. Ich hatte gemeint, sie habe begriffen, dass es zwischen uns zu Ende sei. Doch offensichtlich wollte sie mehr als eine unverbindliche Konversation. Ich blieb distanziert, begann von dem Buch zu reden, in dem ich gerade gelesen hatte. Sie fragte, wie es mir gehe, was ich am Wochenende vorhabe. Darauf ging ich nicht ein, war froh, als ein Kunde eintrat, den ich sofort nach seinen Wünschen befragte. Beatrix liess ich stehen. Sie versuchte noch einmal, ein Gespräch anzuknüpfen, und als ich darauf nicht einging, verliess sie mit kurzen schnellen Schritten den Laden. Ich schaute ihr nach, hatte Bedauern mit ihr und auch ein wenig ein schlechtes Gewissen. Aber was sollte ich tun? Ich liebte Christine und nicht sie, und ich wusste, dass sie sich mit Peter Meyer eingelassen hatte, wobei ich nicht ausschloss, dass sie weniger an Peter interessiert war als er an ihr. Bald vergass ich die Episode wieder. Ich sollte Beatrix nie wiedersehen.
Ein Gewinn meiner Tätigkeit in der Buchhandlung bestand darin, dass ich nicht nur ein wenig Geld verdiente und Zeit hatte zum Lesen, sondern auch das Recht hatte, Bücher zu einem reduzierten Preis zu kaufen. Das nutzte ich aus, nahm viel mehr Bücher mit, als ich zu lesen imstande war, ging dabei sehr unsystematisch vor, griff nach einem klassischen literarischen Text, dann wieder nach etwas Modernem, manchmal versuchte ich mich an soziologischen, geschichtstheoretischen oder philosophischen Texten. Längst nicht alle las ich bis zum Ende; was mich langweilte oder was ich nicht verstand, legte ich beiseite. Auch was zuhause bei meinen Eltern herumlag, las ich zu einem guten Teil, theologische Literatur und Belletristik, die meiner Mutter gehörten, oder ökonomische und soziologische Abhandlungen, die mein Vater bestellt hatte, obwohl er kaum je die Zeit fand, sie zu lesen. Inzwischen hatte ich mich mit Papa geeinigt; er akzeptierte meine Studienwahl, und als das Semester begann, händigte er mir den Betrag für die Einschreibegebühr und ein Taschengeld aus.
Читать дальше