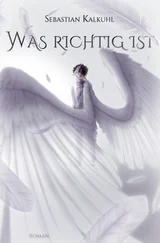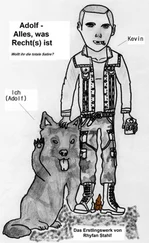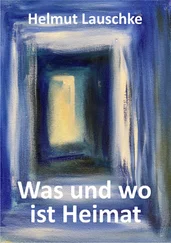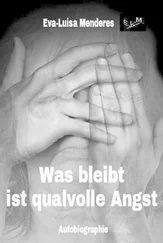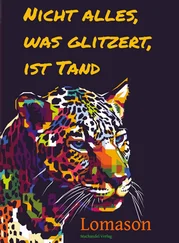Tobias Kaestli - Was war, ist wahr
Здесь есть возможность читать онлайн «Tobias Kaestli - Was war, ist wahr» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Was war, ist wahr
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Was war, ist wahr: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Was war, ist wahr»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Was war, ist wahr — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Was war, ist wahr», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
An die drei anderen Passagiere im Abteil kann ich mich nicht erinnern; über sie steht nichts im Tagebuch. Wahrscheinlich verhielten sie sich unauffällig. Sie sassen einfach auch im Abteil, und als es dunkel wurde, halfen sie, die übereinanderliegenden Couchettes herunterzuklappen, so dass wir uns zum Schlafen betten konnten. Während der Nacht hielt der Zug immer wieder an. Als ich am Morgen erwachte, stand er still, und zwar mitten in einer weiten, flachen Landschaft. Neben dem Bahndamm ragte ein grosser Baum empor und darin war ein Spatzenschwarm versteckt, dessen Gezwitscher mich geweckt hatte. Die Mitreisenden im Abteil begannen sich auch zu regen, die Betten wurden wieder hochgeklappt und wir sassen, ohne viel zu reden, auf den einander gegenüberliegenden Bänken. Ungeduldig wartete ich darauf, dass wir endlich den Berliner Bahnhof Zoo erreichten. Dort verabschiedete ich mich von der Polin und vom Ägypter, stieg mit den anderen drei Mitreisenden aus, die schnell im Gewühl verschwanden. Mit meinem nicht allzu schweren Koffer ging ich langsam Richtung Ausgang, verliess den Bahnhof und liess meinen Blick schweifen. Viele Leute, grosse, aber wenig eindrucksvolle Gebäude, die Eisenbahnbrücke, die zum Bahnhof führte. Dahinter musste der Zoo sein. Mir schien, ich höre durch den Verkehrslärm hindurch irgendwelche Tierlaute. Die Haltestelle des gelben Doppelstockbusses, der mich nach Friedenau bringen sollte, war leicht zu finden. Die Wegbeschreibung hatte mir Hans-Adam brieflich zugestellt. An der Dickhardtstrasse läutete ich bei Ihling. Eine ältere Frau öffnete die Tür, sprach mit starkem Berliner Akzent und zeigte mir das spärlich eingerichtete Zimmer mit Blick auf den Hinterhof. Nachdem ich den Koffer ausgepackt hatte, ging ich zur nahe gelegenen Handjerystrasse, wo Hans-Adam mit seiner Frau Ursula wohnte. Er empfing mich mit blassem Gesicht und sagte, er müsse ins Spital und ich solle mitkommen; Ursula habe soeben eine Tochter geboren. So begann mein Berlin-Aufenthalt mit der Begrüssung eines neuen Menschleins, dessen Köpfchen von einem erstaunlich dichten schwarzen Haarpelz bedeckt war.
Anderntags schrieb ich mich an der Freien Universität (FU) in Berlin Dahlem ein und studierte das Vorlesungsverzeichnis. Ich wusste, dass ich mich gemäss hiesigen Gepflogenheiten vorerst verschiedenen Tutorengruppen anschliessen und mir vom jeweiligen Tutor erklären lassen sollte, welche Lehrveranstaltungen für mich vorgesehen waren. Die grosse Freiheit, die ich an der Uni Bern genossen hatte, gab es hier nicht. Ich hielt mich an die Vorgaben, besuchte die obligatorischen Proseminare und vernahm dort, welche Bücher ich als Vorbereitung zu lesen und was für schriftliche Arbeiten ich bis Ende Semester einzureichen hatte. Der Zugang zu den Forschungsseminaren war erst gestattet, wenn man die Zwischenprüfungen bestanden hatte und damit vom einführenden Grundstudium ins Hauptstudium wechselte. Mir schien, diese einschränkenden Vorschriften seien nicht angebracht. Die Tutorengruppen aber erwiesen sich als hilfreich, und zwar auch deshalb, weil man hier rasch den Kontakt zu anderen Studentinnen und Studenten fand. Was mir komisch vorkam: Solange man sich nicht näher kannte, siezte man sich.
Ich tauchte ein in die Atmosphäre einer Universität, die im Umbruch, und einer Studentenschaft, die hochgradig «politisiert» war. Die Studierenden verstanden die Universität nicht bloss als Ausbildungsstätte, sondern auch als Ort der kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Der Allgemeine Studentenausschuss (AStA) lehnte die vom Berliner Senat vorgeschlagenen neusten Massnahmen zur Studienreform ab, weil er darin eine unangebrachte Sparmassnahme zu erkennen glaubte, die nicht zuletzt darauf abzielte, die Uni zu entpolitisieren und die studentische Kritik zu unterbinden. Neben dem AStA gab es zahlreich politische Studentengruppen, von denen der am weitesten links stehende der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) war. Die politisch aktiven Studierenden druckten und verteilten Flugblätter, machten immer wieder auf ihre Anliegen aufmerksam. Ich war interessierter Beobachter, war aber meistens dabei, wenn eine linke Studentengruppe oder der AStA zu einer Versammlung aufriefen. So auch bei einem Sit-in in der Eingangshalle des zur FU gehörenden Henry-Ford-Baus . Wie alle anderen setzte ich mich auf den Boden, beobachtete und hörte zu. Es ging um die Grosse Koalition, um den neuen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, den einige umstandslos als Nazi bezeichneten, weil er einst Mitglied der NSDAP gewesen war, und um die Notstandsgesetze, die demnächst in Kraft gesetzt werden sollten. Nach ein paar einführenden Worten des AStA-Vorsitzenden Knut Nevermann meldete sich sogleich ein Student zu Wort, der mir schon am Institut für Geschichte als gesprächiger und politisch denkender Kommilitone aufgefallen war. Die Regierung in Bonn sei von allen guten Geistern verlassen, meinte er. Man wisse, wie Hitler das Instrument der Notverordnung zur Beerdigung der Weimarer Republik eingesetzt habe, und das dürfe sich nicht wiederholen. Er bekam Applaus. Einige Heisssporne trieben den Vergleich zwischen der Grossen Koalition und dem Naziregime auf die Spitze: Wieder einmal gehe es darum, die Linke zu zerschlagen, und die SPD gebe sich dazu her. Andere versuchten zu mässigen, aber die Stimmung war aufgeheizt. Eine Studentin in einem schwarz-weiss karierten Faltenjupe und einem weissen Rollkragenpullover erhob sich, und der AStA-Vorsitzende Knut Nevermann erteilte ihr das Wort: «Bitte, Fräulein Kuby», sagte er, wobei er verbindlich lächelte. Sie war die Tochter des Journalisten und Schriftstellers Erich Kuby, der wegen seiner linksliberalen und mit der Studentenbewegung sympathisierenden Haltung bei den Studierenden grosses Ansehen genoss.
Gabriele Kuby hatte also das Wort. Sie brachte begründete Einwände gegen die Grosse Koalition vor und meinte zu den Notstandsgesetzen, diese ermöglichten unzumutbare Eingriffe in die Grundrechte und seien deshalb abzulehnen. Ein Student in Anzug und Krawatte, der sich als Mitglied des Rings Christlich-demokratischer Studenten vorstellte, hielt dagegen: In Einzelheiten seien die Notstandsgesetze wohl kritisierbar, aber grundsätzlich sei es besser, für den Fall einer innenpolitischen Krise ein Gesetz zu haben, als zu riskieren, dass unter dem Druck der Umstände willkürlich und ohne gesetzliche Grundlage repressive Massnahmen getroffen würden. Abgesehen davon sei die Schaffung von Notstandsregelungen eine Bedingung der Alliierten, die erfüllt sein müsse, wenn die Bundesrepublik in absehbarer Zukunft die volle Souveränität erlangen wolle. Während er sprach, erhob sich ein Gemurmel, das zum lauten Protest anschwoll, und ein bärtiger Student rief laut dazwischen: «Imperialistenknecht!». Der Redner geriet aus dem Takt und verwirrte sich beim Versuch, den Unterschied zwischen den aktuellen Notstandsgesetzen und dem Artikel 48 der Weimarer Verfassung darzulegen. Ärgerlich fuhr er sich durchs Haar, wollte sich setzen, entschied sich dann aber für einen eiligen Abgang, was ihm ein Pfeifkonzert eintrug. Zu meinem eigenen Erstaunen sah ich mich in dieser Situation die Hand heben, und Nevermann erteilte mir das Wort. Ich stellte mich als Student aus Bern vor, der bei Walther Hofer studiert habe. Damit wollte ich meine Intervention legitimieren, denn der Berner Geschichtsprofessor Hofer hatte seine wissenschaftliche Karriere an der FU Berlin begonnen und sein Buch über den Nationalsozialismus war ein Standardwerk. Ich könne die besondere Problematik einer Notstandsgesetzgebung für die Bundesrepublik verstehen, sagte ich, die übertriebenen Befürchtungen aber nicht teilen. Dass ein neuer Faschismus in der Bundesrepublik drohe, sei doch aus der Luft gegriffen. Die Argumentation meines Vorredners habe viel für sich. Jedenfalls müsse ein Notstandsgesetz nicht von vornherein schlecht sein. Ich erwartete neue Protestrufe, aber erntete nur nachsichtiges Lächeln. Auch eine grosse Koalition müsse nicht von vornherein schlecht sein, setzte ich hinzu. Jetzt grinsten alle. Wir hätten in der Schweiz seit 1959 eine Allparteienregierung, und man könne wohl kaum behaupten, unser Staat sei keine Demokratie. «Eine Schokoladendemokratie, gelenkt von den Grossbanken» rief der bärtige Student. Einige lachten laut, andere riefen: «Hinsetzen!» Eingeschüchtert liess ich mich zu Boden sinken. Die Debatte ging noch eine Weile weiter, ohne dass jemand auf mein Votum Bezug genommen hätte. Als sich die Versammlung auflöste, kam Fräulein Kuby auf mich zu und teilte mir in gestelzter Sprache mit: «Was Sie zur grossen Koalition gesagt haben, war wohl partiell richtig, wenngleich insofern falsch, als die Regierungssysteme der Schweiz und der Bundesrepublik auf ganz anderen Prämissen beruhen und kaum miteinander vergleichbar sind. Sie haben in der Schweiz direktdemokratische Instrumente, die wir hier nicht haben, und deshalb brauchen wir eine parlamentarische Opposition.» Dass sie mich ansprach, brachte mich etwas aus der Fassung, und ich fand nur die schwache Entgegnung, die meisten hier Anwesenden seien doch der Meinung, die deutsche Bundesregierung sei mit oder ohne Opposition nur scheinbar demokratisch und es brauche so oder so eine ausserparlamentarische Opposition, worauf sie abschliessend meinte, das seien die Extremisten vom SDS, die so redeten, aber man müsse eben auch von einem linksliberalen Standpunkt aus die grosse Koalition bekämpfen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Was war, ist wahr»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Was war, ist wahr» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Was war, ist wahr» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.