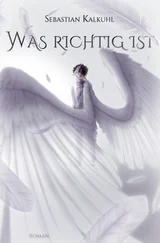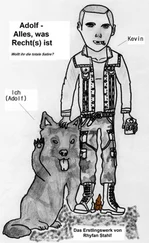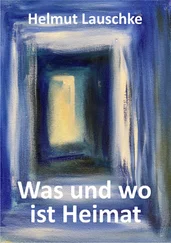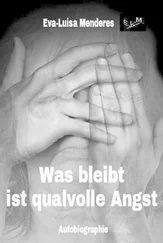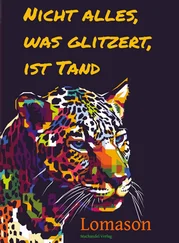Ich wolle das tun, sagte ich und dankte ihr für den Hinweis. Dann gab ich den Hörer an meine Mutter weiter, die ihre Schwester begrüsste und sich nach ihrem Wohlergehen erkundigte, um dann lange still zuzuhören. Aus den Geräuschen, die aus dem Telefonhörer bis zu mir herüberdrangen, schloss ich, dass Laure mit wachsender Erregung noch einmal erzählte, was sie mir schon gesagt hatte. Mama redete ihr begütigend zu, was sie wahrscheinlich nur noch mehr aufregte, da sie doch von ihrer älteren Schwester Zustimmung und Unterstützung erwartete. Aber das gehörte eben dazu, dass die beiden bei aller Liebe und Verbundenheit von sehr unterschiedlichem Temperament waren.
Ich behändigte die NZZ, die auf dem Stubentisch lag, und blätterte nach Staigers Rede. Der Text stand unter dem Titel «Literatur und Öffentlichkeit», und ich begann aufmerksam zu lesen. Zuerst fand ich die Rede langweilig, dann aber wurde es happig: Der berühmte Professor Staiger, Lehrer und Forscher an der Universität Zürich, feinsinniger Interpret der Texte der deutschen Klassik, dessen Vorlesungen nicht nur von Studentinnen und Studenten, sondern auch von einem weiteren Publikum gebildeter oder bildungsbeflissener Damen und Herren besucht wurden, scheute sich tatsächlich nicht, in seiner Ansprache die Littérature engagée als «entartet» zu bezeichnen und ihre Vertreter, die engagierten Literaten, der Verantwortungslosigkeit zu zeihen. Wahre Literatur, sagte er, sei nur dort, wo den Ansprüchen Genüge getan werde, wie sie Schiller und Goethe gültig formuliert hätten: «Schiller gelingt es, in den ‚Briefen über die ästhetische Erziehung der Menschen’ die aller Dienstbarkeit enthobene Souveränität des Schönen mit ihrem für die Menschheit als solche unentbehrlichen Sinn in Einklang zu bringen. Und noch der späte Goethe weist sogar dem einsamsten unter den Dichtern, dem Lyriker nämlich, die Aufgabe zu, ‘den edlen Seelen vorzufühlen’, das heisst, in auserwählten Herzen die Wege des Gefühls zu bahnen und so dem bisher Unaussprechlichen zum Bewusstsein zu verhelfen.»
Was Goethe und Schiller um 1800 als Aufgabe des Dichters ansahen, galt Staiger im Jahr 1966 immer noch als Norm. Und er verurteilte diejenigen, die seiner Meinung nach die Norm verletzten: Viele moderne Schriftsteller seien von den Höhen des dichterischen Auftrags hinuntergestiegen in die schlüpfrigen Niederungen des Gemeinen und Verbrecherischen. «Man gehe die Gegenstände der neueren Romane und Bühnenstücke durch. Sie wimmeln von Psychopathen, von gemeingefährlichen Existenzen, von Scheusslichkeiten grossen Stils und ausgeklügelten Perfidien. Sie spielen in lichtscheuen Räumen und beweisen in allem, was niederträchtig ist, blühende Einbildungskraft.» Staiger nannte keine Namen, liess nur einen einzigen Schriftsteller erkennbar werden, und zwar den von mir so bewunderten Peter Weiss: «Wenn ein bekannter Dramatiker, der Auschwitz auf die Bühne bringt, in einem früher verfassten Stück mit Marquis de Sade als Helden einen Welterfolg errungen hat, so nehmen wir an, er habe hier wie dort die ungeheure Macht des Scheusslichen auf das heutige Publikum einkalkuliert und sich natürlich nicht verrechnet. Denn wenn man anfängt, nur das Ungewöhnliche, Einzigartige, Interessante als solches zu bewundern, führt der Weg unweigerlich über das Aparte, Preziöse zum Bizarren, Grotesken und weiter zum Verbrecherischen, das nicht als Widerspiel in unserer Einbildungskraft ein wohlgeratenes, höheres Dasein evoziert, das vielmehr um seiner eigenen Reize willen gekostet werden soll und meistens auch gekostet wird.» – Darauf folgte dieser Satz, der berühmt-berüchtigt werden sollte: «Wenn solche Dichter behaupten, die Kloake sei ein Bild der wahren Welt, Zuhälter, Dirnen und Säufer Repräsentanten der wahren, ungeschminkten Menschheit, so frage ich: In welchen Kreisen verkehren sie?»
Da sprach einer tapfer, wie er meinte, gegen Dekadenzerscheinungen der Gegenwart und merkte nicht, welch bedrängende Fragen die Gegenwartsliteratur stellte. Die Passage über Peter Weiss schien mir zu beweisen, dass der ältliche Herr Professor Staiger die Welt nicht mehr verstand. Ich kann nicht sagen, dass ich besonders empört war. Staigers Weltsicht war mir so fremd, dass ich eigentlich bloss mit den Schultern zuckte.
Anderntags las ich Hugo Lebers ironischen und gelehrten Kommentar im «Tages-Anzeiger». Er sagte mir nicht viel. Anders die sehr persönlich gehaltene Antwort Max Frischs, die ein paar Tage später in der «Weltwoche» erschien; sie klärte und verstärkte, was ich selbst auch empfand. Frisch schrieb seinem ehemaligen Universitätslehrer, mit dem er inzwischen per Du war: «Einmal vor Jahren hast du mich belehrt, dass dieser Brecht nur drum von ‚Epischem Theater’ schwadroniert, weil er keine richtigen Stücke zu schreiben imstande ist, und mein andrer verehrter Lehrer, Walter Muschg, hat mich anlässlich der deutschen Erstaufführung von ‚Furcht und Elend des Dritten Reiches’ ebenfalls unterrichtet, dass da von Dichtung nicht die Rede sein könne und dass unser Cabaret das besser mache.» Frisch widersprach Staiger, wo dieser meinte, die Politik habe, da zeitgebunden, nichts mit Dichtung zu tun. Er sagte klar und deutlich: «Die Naivität des apolitischen Dichters ist an diesem Platz nicht statthaft.» Staiger sei von seiner «überzeitlichen Warte aus», zielstrebig in die Irre gegangen. «Plötzlich unterscheidest du, wenn es um heutige Literatur geht, nicht einmal zwischen Autoren und sprichst ohne jeden Beleg, ohne Namen, ohne Haft, ohne Unterscheidung, als wäre das Unterscheidungsvermögen nicht gerade die Tugend, die du lehrst, eine Voraussetzung grosser Kritik.» Und ironisch setzte er hinzu: «Deine Rede, meisterlich in übernommener Sprache, wirkte befreiend: Endlich kann man wieder von Entarteter Literatur sprechen.» Damit deutete Frisch an, dass Menschen, die wie Staiger eine weltfremde Schöngeistigkeit pflegten, in ihrer Abkehr von den Problemen der Gegenwart Gefahr liefen, wie in der Zeit des Nationalsozialismus die Augen vor den Akten der Barbarei zu verschliessen, die sich direkt vor ihrer Haustür abspielten.
Die Rede Staigers und Frischs Erwiderung darauf waren für mich sehr wichtig. Ich glaubte nun zu wissen, welcher Art von Literatur ich vertrauen konnte und welcher nicht. Alles was Staiger unter dem Titel «Littérature engagée» verdammte, war für mich von nun an das Richtige und Wichtige. Literatur musste sich auf die aktuellen gesellschaftspolitischen Probleme einlassen. Dass Frisch Recht hatte und Staiger irrte, stand für mich fest. Denn es gab eine Pflicht zum Engagement, so wie es Sartre dargelegt hatte, und das galt auch für die Literatur. Aber musste dieses Engagement in der Literatur als bestimmte politische Meinung direkt zum Ausdruck kommen? Max Frisch zweifelte später daran. 1981 hielt er am City College in New York zwei Vorlesungen, in denen er sich mit den Motiven des Schriftstellers auseinandersetzte und sich dabei von einem engen Begriff der «Littérature engagée» distanzierte: «Ich sage nicht, dass Literatur nichts vermag. Ich meine: Sie vermag mehr, wenn sie nicht direkt politisch ist.» Und er fügte hinzu, dass er «heute, im Gegensatz zu früheren Jahren, eine direkt-politische Literatur für ein Missverständnis» halte.
Ich verstehe das nicht als ein Umschwenken Frischs auf die Linie Staigers, sondern als eine feine Korrektur, die gewiss auf Erfahrung und Einsicht beruhte. «Direkt politische» Literatur hat sich immer wieder als fragwürdige Propaganda erwiesen, vor allem dort, wo sich Schriftsteller einem Regime andienten und sich aus purem Opportunismus die gewünschte politische Linie zu eigen machten, wie es nicht selten in der Zeit des Nationalsozialismus und des Stalinismus geschah. Auch in freiheitlicheren gesellschaftlichen Verhältnissen kann «direkt politische» Literatur in die Irre führen, wenn ein Schriftsteller, im Glauben, der «guten Sache» zu dienen, und in der Überzeugung, die Wahrheit erkannt zu haben, mit verengtem Blick ans Werk geht, so dass er dem, was Kunst zu leisten vermag, nämlich den Horizont zu weiten, im Grunde genommen entgegenarbeitet.
Читать дальше