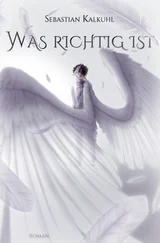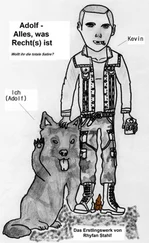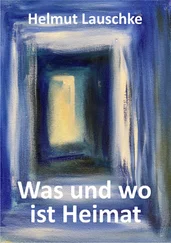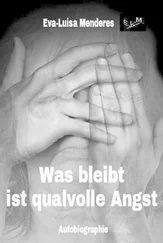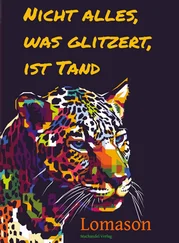Der Vorfall lehrte mich zwei Dinge, nämlich erstens, dass die Berliner Studentenbewegung keineswegs so einheitlich war, wie sie in den Medien dargestellt wurde, und zweitens, dass ich mich als Schweizer daran gewöhnen musste, von den deutschen Kommilitonen und Kommilitoninnen zwar mit Nachsicht und einer gewissen Sympathie, aber auch ein wenig von oben herab behandelt zu werden. Das war jedenfalls mein vorläufiges Fazit. Allzu lange dachte ich darüber nicht nach. Vordringlich schien mir, Berlin zu entdecken. In den nächsten Tagen streifte ich zu Fuss, per Bus, U-Bahn und Stadtbahn kreuz und quer durch die Stadt. Was mich vor allem überraschte: Die Spuren der Bombardierungen am Ende des Krieges, der ja nun mehr als zwanzig Jahre zurücklag, waren überall zu sehen. Unterbrochene Häuserzeilen, unbebaute Areale, zum Teil noch mit Schutt überhäuft, notdürftig aufgerichtete Gebäude, schiefe Trottoirs. Man musste achtgeben, wo man hintrat, denn überraschende Unebenheiten und Löcher im Asphalt waren nicht selten. Nachts waren die Strassen in den Aussenquartieren nur spärlich beleuchtet, und wenn es nieselte oder regnete, wirkte die Stadt trostlos. Lieber hielt ich mich dann in Innenräumen auf, in der schönen Bibliothek der FU oder abends in den Kinos oder Theatern in West- und Ostberlin.
1 Faust II
Das Hauptereignis der Theatersaison war «Faust II» am Schiller-Theater, inszeniert von Ernst Schröder. Er galt als einer der profiliertesten Schauspieler Deutschlands, und jetzt bewährte er sich auch als Regisseur. Was er zusammen mit seinem Dramaturgen Hans Mayer aus Goethes Faust machte, wurde von der Presse teils hoch gelobt, teils heftig getadelt, wobei der Tadel eher auf Mayer denn auf Schröder gemünzt war. Mayer sei mit seiner marxistischen Interpretation dem Stück nicht gerecht geworden, meinten einige Kritiker. Sie erinnerten daran, dass er lange in der DDR gelebt habe. Das irritierte mich. War er ein Dogmatiker, ein linientreuer Kommunist? Genaueres konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Erst Jahre später las ich einige seiner literaturwissenschaftlichen Aufsätze, und als 1982 seine Autobiografie «Ein Deutscher auf Widerruf» erschien, verschlang ich sie mit innerer Anteilnahme. Mayer war in Köln aufgewachsen, hatte Rechts- und Staatswissenschaft studiert und promovierte 1930 beim berühmten Staatsrechtler Hans Kelsen. Er trat der SPD bei und schrieb für die Zeitschrift «Der Rote Kämpfer». Nach der Machtergreifung der Nazis erhielt er Berufsverbot. Als Jude, Marxist und Homosexueller war er im NS-Staat dreifach gefährdet. Im August 1933 emigrierte er nach Frankreich und kam 1934 in die Schweiz. An der Universität Genf konnte er bei Hans Kelsen arbeiten, der ebenfalls aus Deutschland geflohen war. Dort traf er auch mit Max Horkheimer zusammen. Sein juristisches Erststudium ergänzte er durch ein literaturgeschichtliches Studium, das er mit einer Dissertation über Georg Büchner abschloss. 1942 wurde er wegen seiner Homosexualität in den Strafanstalten Witzwil und Lenzburg je sechs Monate lang eingesperrt. «Homosexuelle Kontaktnahme an öffentlichen Orten» wurde nach damaligem schweizerischem Strafrecht mit Gefängnis bestraft. Nach seiner Entlassung aus der Haft lebte er in fünf verschiedenen Arbeitslagern für Flüchtlinge und gehörte dem leitenden Ausschuss der Kulturgemeinschaft der Emigranten an. Obwohl der Schweizerische Vaterländische Verband dagegen protestierte, durfte er öffentliche Vorträge halten. Am 8. November 1945 kehrte er nach Deutschland zurück, zunächst in die amerikanische Besatzungszone. Im Einverständnis mit der US-Verwaltungsbehörde wurde er Kulturredaktor bei der Deutschen Nachrichten-Agentur . Seine Eltern waren in Auschwitz ermordet worden. Noch vor der Gründung der DDR ging er zusammen mit seinem Freund Stephan Hermlin in die sowjetische Besatzungszone und wurde Professor für Literaturwissenschaft in Leipzig. Spätestens seit 1956 kehrte er sich innerlich von der DDR ab. 1963 blieb er nach einer Vortragsreise nach Tübingen in der Bundesrepublik. Zwischen 1964 und 1967 moderierte er zusammen mit Marcel Reich-Ranicki die Radiosendung «Das literarische Kaffeehaus». 1965 bekam er eine Professur für deutsche Literatur an der Technischen Hochschule Hannover. Seine dramaturgische Arbeit für das Schiller-Theater war also nur ein Nebengleis. Nach seiner Emeritierung 1973 war er Honorarprofessor in Tübingen. Dort starb er 94-jährig.
Der Umstand, dass Mayer an der Inszenierung von Faust II mitwirkte, eröffnete mir damals einen neuen Kosmos. Der Vorwurf, er habe eine marxistische Tendenz in das Stück gebracht, liess mich darüber nachdenken, was denn eigentlich eine marxistische Interpretation von Literatur sei. Mein Interesse für Mayers Schriften hatte da seinen Ursprung. Was ich mir später an Wissen über Mayer und sein Werk aneignete und auch das, was ich über Schröder herausfand, der schon in der Nazizeit ein gefeierter Schauspieler war, beeinflusst meine Erinnerung an den Theaterabend. Um dennoch möglichst nahe an meinen ursprünglichen Eindrücken zu bleiben, zitiere ich zunächst aus dem Tagebuch: «Faust I habe ich schon als Gymnasiast gelesen, an Faust II aber habe ich mich bis jetzt nicht herangewagt. Das hole ich nun nach, um so vorbereitet die Aufführung zu besuchen. Die Lektüre ist harte Arbeit, ich habe Mühe, den Text zu verstehen. Mein allgemeiner Eindruck: In Faust II entfaltet Goethe ein Welttheater, das in einer Vielfalt unterschiedlicher Szenen die Widersprüchlichkeit menschlichen Handelns in allgemeingültiger Art veranschaulichen soll. Es geht um hohe Ideale, grossartige Errungenschaften und erotische Verführung.»
Nach dem Besuch der Vorstellung machte ich mir zunächst Gedanken über die Art, wie Schröder das Stück anschaulich machte: «Die Inszenierung auf der grossen Bühne des Schillertheaters war ein Bilderrausch, der die gesprochene Sprache manchmal fast zudeckte. In der Sequenz, in der sich die Kaiserfamilie das Techtelmechtel zwischen Paris und Helena im Zauberspiegel ansieht, überlässt es Schröder nicht dem Zuschauer, sich anhand des gesprochenen Textes den Ablauf selbst auszumalen, sondern er führt ihn filmisch vor. Die Helena, die auf der Leinwand erscheint, ist nicht identisch mit derjenigen auf der Bühne. Diese ist mager und eckig, die Film-Helena ist viel schöner; ihre üppige Figur schimmert durchs weisse Gewand, ihr schwarzes Lockenhaar spielt um die nackten Schultern, auf ihrem zierlichen Füsschen sitzt ein flatterndes Täubchen. Nach dieser erotisch aufgeladenen Szene, die mich aufs höchste erregt hat, ist mir die zweite Hälfte der Aufführung ein wenig langfädig vorgekommen; sie schleppt sich dahin bis zur Landgewinnungsszene: Faust ist jetzt ein Grossunternehmer, ein Kapitalist, der dem Teufelspakt nicht entrinnen kann. Sein Wirken erweist sich gleichzeitig als segensreich und zerstörerisch. Ich mag die Akzentuierung der negativen Folgen, wie sie diese ‘linke’ Inszenierung vornimmt, nicht so recht akzeptieren. Während der vorgängigen Textlektüre ist mir das faustische Tun als etwas Grossartiges vorgekommen. Gerade darum, weil Faust den Teufel braucht, um seine idealistischen Ziele zu erreichen, werden sie umso bedeutender. Oder haben Schröder/Mayer am Ende doch Recht? Sind die idealen Ziele eigentlich nur eine Verschleierung wirtschaftlicher Interessen? Ist in der modernen Welt die Gier nach Geld letztlich die Triebfeder allen Tuns? Ist das Ideal der Goethezeit, ‘tätig frei’ zu leben, im 20. Jahrhundert eine unverantwortliche Anmassung? Ist es im Zeitalter der Atombombe vielleicht notwendig, das Grossartige zu unterlassen? Das ‘ewig Weibliche’, das Faust am Ende des Stückes ‘hinan zieht’, empor zu den wahrhaften Idealen, wird in Schröders Inszenierung zur Orientierung an den wirklichen Bedürfnissen des alltäglichen Lebens. Das faustische Tun erscheint dagegen als gefährliche Überhebung. – Goethe so zu interpretieren, erscheint mir kühn und interessant. Andererseits frage ich mich, ob das Stück nicht dazu missbraucht wird, Zustände wie im Sozialismus zu propagieren: Sicherheit statt Freiheit! Sozialismus statt Kapitalismus! Ich komme zu keinem eindeutigen Schluss. Geht die Freiheit tatkräftiger Menschen immer auf Kosten der ‘gewöhnlichen’ Menschen? Muss man die kühnen Menschen, die vor dem Pakt mit dem Teufel nicht zurückschrecken, zurückbinden, oder führt die Beschneidung ihrer Freiheit zu einer allgemeinen Unfreiheit? Was ist Freiheit? Bedeutet sie Regel- und Zügellosigkeit? Oder ist es umgekehrt so, dass gerade das Einhalten von Spielregeln die Freiheit garantiert?»
Читать дальше