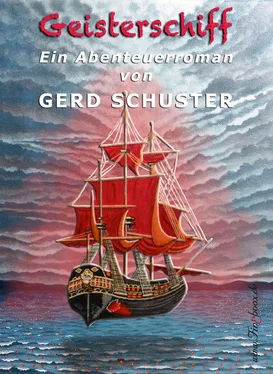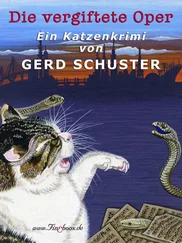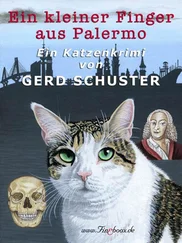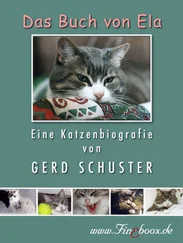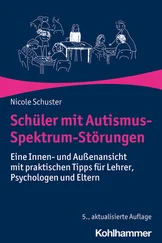Es dauerte ein paar Momente, bis ich in die Realität zurückgefunden hatte. Im Dienst soll man eben nicht träumen. Ich drückte den Sprechknopf an meinem Mikrofon und gab den Piloten durch: »Bitte sofort einen GPS–Fix machen!« »Schon passiert, Sir!« kam die Antwort aus dem Cockpit. »Wunderbar«, sagte ich, »bitte drehen Sie um – wir fliegen zurück.«
Der Pilot schwieg ein paar Sekunden verblüfft, dann fragte er zurück, höfliche Zweifel in der Stimme: »Haben Sie etwas auf dem Meer entdecken können, Mr. Cunningham? Wir haben aus dem Cockpit keinerlei Treibgut beobachtet, obwohl wir wie Schießhunde aufgepasst haben. Radar und Wärmebildkamera sind auch negativ.« Als Antwort brummte ich nur. Es sollte bejahend oder dankbar klingen. Ich hatte zwar ebenfalls nichts gesehen; aber was sollte ich den beiden Fliegern erzählen?
Endlich hatte ich ein Zeichen! Mein eingebautes Ortungssystem hatte angesprochen, die Botschaft des Meeres war angekommen! Da unten musste etwas sein! Dort in der Tiefe! Ich schaute wieder aus dem Fenster: Majestätisch und unbeirrbar zogen die Wellen unter mir nach Backbord. Sie sahen aus wie ein gewaltiges Heer grauer Tierrücken, das in perfekter Disziplin und voll unerschütterlichen Sendungsbewusstseins in eine Schlacht marschierte und sich von nichts aufhalten lassen würde.
Die Sonne war hinter Wolken verschwunden, und die See hatte ein dumpfes Elefantengrau angenommen. Die meisten Wellenkämme trugen jetzt Schaumkronen. Es war faszinierend, zu beobachten, wie die »weißen Pferde« entstanden, wie unterschiedlich lang und breit sie waren, wie einige minutenlang auf ihren Wogen surften, andere nach Sekunden vergingen, abgestreift wurden oder sich mit ihrem Wellenkamm überschlugen.
Außer unendlich viel Wasser war nichts zu sehen. Aber da unten musste etwas sein! Ich musste wiederkommen – mit einem Schiff. Das würde Lloyd’s wieder einiges kosten – oder mich. Denn wenn Hogg schneller war, blieb ich auf allen Kosten sitzen. Und umgekehrt.
Das konnte teuer werden – besonders, wenn man das Geld mit vollen Händen ausgab wie ich, und wenn man einer Expedition ohne konkretes Ziel gleich die nächste folgen ließ. Ich machte mir keine Illusionen, dass das, was ich vorhatte, mein zweiter Schuss ins Blaue war. Denn was ich suchte, stellvertretend für die »Palermo Express«, wusste ich immer noch nicht. Aber ich war zuversichtlich, dass die Fährte, auf die mich mein siebter Sinn gesetzt hatte, zu etwas führte, das mir das Schicksal des Containerriesen klären half.
Fischfrikadellen mit Fadenwürmerwürze
oder
Eine einsame Nixenfluke geht ins Netz
Meine Genugtuung, endlich eine Spur gefunden zu haben, hielt nur bis zum Jachthafen von Port Elizabeth vor und zerplatzte dort wie eine Seifenblase. Denn das erste, was ich nach meiner Ankunft sah, war Hamish Hogg. Er stand in all seiner Körperfülle auf der Brückennock eines schicken weißen 20– Meter–Kajütkreuzers, der vor etwa fünf Minuten seinen Liegeplatz an der Pier verlassen haben musste und in langsamer Fahrt in die glockenblumenblaue Algoa Bay hinausdampfte. Hogg schaute zum Kai zurück, als halte er nach mir Ausschau, und sein rosiges Vollmondgesicht leuchtete im frühen Abendlicht wie ein chinesischer Rundlampion.
Die feiste Gestalt auf der Jacht war schon eine halbe Meile entfernt, aber es war unverkennbar mein Gegenspieler von Waters, Windermere und Winchester. Solche Pausbacken und ein derart multiples Kinn gab es in dieser Färbung – exakt im Ton der Schnittfläche eines Laibs gekochten Schinkens, wie er in britischen Pubs an der Sandwich-Bar bereitlag – in Verbindung mit der Geckenbrille und der blonden Oscar–Wilde–Frisur nur einmal auf dem Globus.
Ich hatte Seine Monstrosität kaum erblickt, als der Kajütkreuzer wie zum Hohn mit lautem Dieselröhren Fahrt aufnahm. Der Bug hob sich, das Kielwasser schäumte weiß, und das Boot zog rasch davon.
Wie vom Donner gerührt, blieb ich im Taxi sitzen, das mich gerade vom Flughafen zum Kai gebracht hatte. Der schwarze Fahrer deutete mein Zögern falsch und erklärte mir überflüssigerweise, wir seien am Fahrtziel angekommen. Also kramte ich umständlich in meinen Taschen nach Geld, um Zeit zu schinden.
Ich versteckte mich im Wagen, bis Hogg sich umdrehte, ins Steuerhaus trat und die Tür hinter sich zuzog. Ich war sicher, dass er mich nicht gesehen hatte. Diesen Triumph gönnte ich dem Adipösus nicht. Er sollte nicht wissen, dass er mir zuvorgekommen war.
Ich hätte mir das Versteckspiel sparen können; denn bald wurde offenbar, dass die Kanaille bereits mit meiner Ankunft gerechnet hatte, als ich im Helikopter saß und selber noch gar nicht wusste, dass ich mich in PE, wie die Einwohner von Port Elizabeth ihre Stadt nannten, einschiffen würde. Und dann hatte er es irgendwie geschafft, sämtliche für mich infrage kommenden Boote zu blockieren.
Wie ihm das gelungen war, wusste ich nicht, aber alle Ausflugsboote waren ausgebucht, zum nächsten Tag gechartert oder in der Wartung, nur Wochen im Voraus zu mieten, ausgelaufen oder defekt. So viele Boote mit Maschinen–und Elektronikschäden hatte es noch nie in einem Hafen gegeben.
Ich versuchte es bei den Touristendampfern, den Tauchern, den Big–Game–Fischern und sogar bei einigen Freizeitkapitänen. Aber die winkten ab, als sie hörten, wie weit ich raus wollte. Ich bot fünftausend Dollar – vergebens.
Ziemlich angefressen ging ich zum Büro des Hafenkapitäns, stellte mich mit Jachteignern, die ihre Liegegebühren zahlen wollten, in eine Schlange und schilderte ihm, als ich an der Reihe war, mein Problem. Zuerst wollte mich der kleine Mann mit dem weißen Schnurrbart abwimmeln. Aber er wurde freundlich, als ich erwähnte, dass ich für Lloyds unterwegs war, und riet mir, es im Fischereihafen zu versuchen. Wie überall auf der Welt litten auch in Südafrika die Trawler unter ständig schrumpfenden Fangmengen, sagte er, und ihre Kapitäne bräuchten Geld.
Ich nahm den Rat an und fuhr zum wenige Kilometer entfernten Fischereihafen. Er war schmuddelig, feucht, chaotisch und übelriechend wie alle Fischereihäfen der Welt, und es ging rau zu. Ich musste mich mit einem Sprung vor einem wahnsinnigen Gabelstaplerfahrer in Sicherheit bringen, der mit Vollgas um ein Gebirgsmassiv aus leeren blauen Fischkisten herumgerast kam.
Die ersten sechs Kutter waren menschenleer. Auf drei der nächsten acht oder zehn traf ich brummige Schwarze an, die Netze flickten, das Deck abspritzten, Rost klopften oder Löcher in die Luft starrten. Sie wollten nicht mit mir reden – vielleicht störte sie mein Oberhaus–Englisch – oder erklärten, der Kapitän sei von Bord, und sie hätten nichts zu sagen.
Endlich hatte ich Glück. Auf einem besonders verlotterten Kutter, dessen einstmals moosgrüne Bordwände mit zimmertürgroßen Roststellen und ebenso ausgedehnten Menningeflecken übersät waren und der im Schanzkleid des Steuerbordbugs eine metergroße Beule hatte, war der Skipper anwesend. Er war ein Weißer mit ölverschmierter Glatze, der vor lauter Muskeln und wohl auch Speck beinahe aus seinem Blauen Anton platzte. Er schraubte und hämmerte unter dem A–Mast auf dem Fangdeck mit einem mageren schwarzen Matrosen an einer verrosteten Kurrleinen–Winsch herum. Das ist eine der Winden, die das Netz über die Heckrampe an Bord ziehen. Ein Trawler hat mindestens zwei davon.
Als der Seemann hörte, um was es ging, ließ er den Schraubenschlüssel fallen, kam in großen Schritten auf den Kai marschiert, packte den Ärmel meines Sakkos, zog mich ziemlich rüde über die Gangway auf die Brücke und knallte die Tür hinter mir zu. Das Steuerhaus war ebenso verlottert wie der ganze Kutter, aber das GPS schien mir auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Dafür waren die sieben Halbliter–Bierdosen, die zwischen GPS und Echolot lagen, sämtlich leer.
Читать дальше