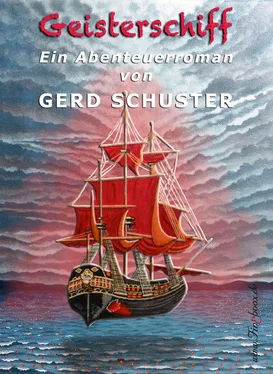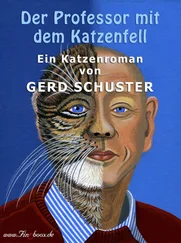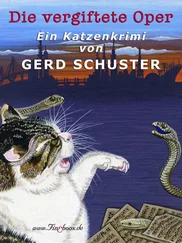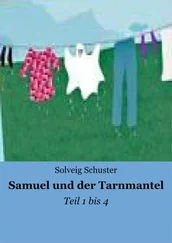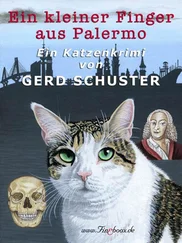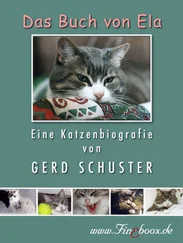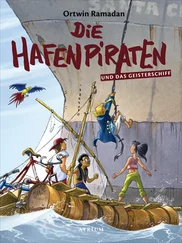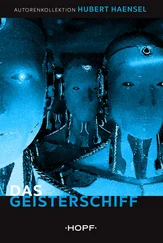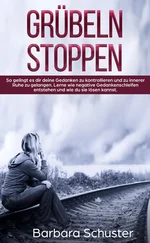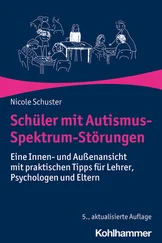Um nicht als müßiger Nutznießer einer übersinnlichen Begabung – oder wie man meine mentalen Mitteilungen sonst nennen möchte – dazustehen, muss ich erwähnen, dass die Träume allein relativ wenig aussagten. Es kam auf ihre Interpretation an. Denn ich war kein Hellseher – leider! Mir fiel die Lösung meiner Fälle also keineswegs wie die sprichwörtliche reife Frucht in den Schoß, während ich schlief, wie das bei einer »echten« übersinnlichen Begabung der Fall gewesen wäre. Niemand flüsterte mir ein, pst, das gesuchte Tankschiff liegt drei Meilen vor dem Hafeneingang von Brixham in Cornwall oder dreißig Meilen westsüdwestlich von Martinique. Ich hatte Eingebungen von Namen und Orten, denen ich nachgehen musste. Ab und zu sah ich auch Gegenstände, die Symbole für die Lösung eines Falles waren oder sein konnten. Oder ich bekam an bestimmten »heißen« Orten Hitzegefühle an der Sohle meines linken Fußes. Das waren aber immer nur hints, wie es im Englischen heißt – Fingerzeige, Andeutungen, Winke. Es war meine Aufgabe, etwas aus ihnen zu machen. Und das war oftmals recht mühselig.
Ich will versuchen, das zu erklären. Nehmen wir an, ich träumte von einer alten Burg. Gut, ich sah also das Gemäuer; den Sinn des Traumbildes bekam ich aber nicht mitgeliefert. Den musste ich herausfinden. Manchmal gelang das, manchmal nicht.
Der Hint konnte beispielsweise bedeuten, dass es um ein Schiff ging, dessen Name mit »Castle«, »Burg« oder »Burgh« anfing oder aufhörte, und davon gab es unzählige, oder dass die Reederei das Wort in ihrem Namen führte oder in Newcastle beheimatet war beziehungsweise in Hamburg oder Cherbourg.
Das Gleiche galt für die Entsprechung von »Castle« in allen gängigen Sprachen – castillo, castello, castelo, château, fort, und so weiter. Es konnte auch »Fort« gemeint sein – oder der Berg, auf dem die Burg stand. Einfach war es nicht; auf jeden Fall machte er mehr Kopfzerbrechen als das Kreuzworträtsel der »Times«. Eigentlich war es ein Wunder, dass ich die Zeichen so oft richtig deutete. Ich verließ mich da ganz auf mein »Bauchgefühl« und fuhr gut damit.
Ich hatte mir das Bild der merkwürdig plumpen Schwanzflosse oder Fluke Dutzende Male vor Augen gerufen und nach einem Hinweis gesucht – vergeblich. Mir war nur aufgefallen, dass sie tropfnass gewesen war. Das war bei Flossen zwar nichts Ungewöhnliches, aber es hatte mich dennoch veranlasst, nach Port Elizabeth zu fliegen und den Hubschrauber zu chartern.
Wenn man aufs Meer hinauswollte, einen »Offshore«–Flug vorhatte, wie das im Branchenjargon hieß, musste der Helikopter über zwei Triebwerke verfügen. Wenn man 150 Seemeilen weit hinaus wollte und natürlich wieder zurück, war eine entsprechende Reichweite nötig. Also kam nur eine große Maschine infrage. Ich hatte einen nagelneuen Sikorsky S92 gechartert, einen fliegenden Bus mit einem gewaltigen Rotor, zwei mächtigen Gasturbinen von je 1877 Kilowatt Leistung und 19 Plätzen in einer sechs Meter langen Kabine. Mutterseelenallein saß ich nun in Reihe eins, dem leeren Platz der Flugbegleiterin gegenüber, deren Kopfhörer–Buchse ich benutzte.
Der dicke Brummer hatte eine Reisegeschwindigkeit von 150 Knoten und etwa 400 Meilen Reichweite plus Reserve. Und er war entsprechend teuer – 50 Dollar die Minute, was auf 3000 Dollar die Stunde hinauslief. Eine Stunde Anflug, eine Stunde Suchen, eine Stunde Rückflug, das machte 9000 Dollar. Gut, dass meine Auftraggeber keine Kenntnis davon hatten, wie wenig konkret meine Gründe waren, ihr Geld zu verpulvern.
Nur Laxmi wusste, dass ich meine Erfolge zum Teil Träumen, Eingebungen und überfallartig auftretenden Empfindungen verdankte. Laxmi, das war meine Lebensgefährtin. Als Inderin und Hindu hatte sie nicht nur Verständnis dafür, sondern sie hielt die Tipps aus dem Jenseits – oder wo immer sie herkamen – für normal. Auf jeden Fall für nicht besonders ungewöhnlich.
Der elefantenköpfige Gott Ganesha stecke dahinter, sagte sie. Ganesha sei der »great achiever«, der Gott, der dafür sorge, dass Wünsche wahr würden. Sie hatte mir barocke Geschichten aus der Wunderwelt der hinduistischen Mythologie erzählt, aber ich hatte immer noch keinen rechten Überblick über den Olymp der Hindus. Natürlich kannte ich mich neben Ganesha einigermaßen mit Brahma, Shiva und Vishnu, Hanuman und Krishna aus, aber ich musste immer wieder nachfragen. Das lag nicht nur daran, dass es Millionen Götter gab, sondern hatte damit zu tun, dass jeder Gott gern in anderer Gestalt und unter anderem Namen auftrat. Deshalb war man auch, wenn man die Götter–Schwemme ignorierte und sich sieben oder acht Himmelsbewohner aussuchte und diese verehrte, nicht gegen Überraschungen gefeit. Für jeden der verwandlungsfreudigen Unsterblichen gab es Listen verschiedener, sorgfältig durchnummerierter Inkarnationen.
Laxmis Götter waren mir sympathisch, und wenn ich etwas für Religion übrig gehabt hätte, wäre ich wohl Hindu geworden, vielleicht auch Buddhist oder Sikh. Keiner der drei musste sich nämlich lebenslang mit Katalogen zumeist kleinkarierter Verbote herumschlagen, was man als Christ, vor allem als Katholik, zu tun gezwungen war. Mindestens ebenso wichtig war, dass in diesen drei Konfessionen die ständige Beobachtung und Bevormundung durch herrschsüchtige Kleriker entfiel, die man als gläubiger Christ, Jude und Moslem nur erdulden musste.
Außerdem gab es im Hindu–Himmel keine hehren Lichtgestalten, sondern da tummelten sich – wenn man die Tiere oder Flüsse einmal außer acht lässt – Wesen mit menschlichen Emotionen und Gelüsten. Ganesha etwa hatte sich einmal so mit Kuchen vollgestopft, dass er geplatzt war. Er hatte sich zwar eine zufällig greifbare Kobra um den Bauch gebunden, um den Schaden in Grenzen zu halten; weil der Mond und die Sterne aber über sein Missgeschick lachten, geriet er in cholerische Wut. Er brach einen seiner Stoßzähne ab – andere Wurfgeschosse waren nicht zur Hand – und schleuderte das Elfenbeinstück nach dem Mond.
Laxmi war 29 Jahre alt, 1,74 m groß, in einem wunderbaren Maße gleichzeitig schlank und weiblich–durchtrainiert, scharfsinnig, manchmal sogar absolut brilliant, und schön. Sie hatte eine helle Haut mit einem delikaten hellbraunen Schimmer, eine scharf geschnittene Nase über einem großen, vollen Mund, Zähne wie aus der Colgate–Reklame, große blauschwarze Augen und hüftlange Haare der gleichen Farbe. Im Sari sah sie wie die Märchenprinzessin aus, die sie war; in Jeans war sie einfach atemberaubend.
Ihre Leidenschaft war ebenso unermesslich wie ihre Liebe, ihr Hass und ihr Freiheitsdurst. Sie war das Ergebnis jahrhundertelanger akribischer Stammbaum– und Dynastieplanung, denn sie war eine Prinzessin aus dem rajasthanischen Singhgeschlecht, einem uralten hinduistischen Königsclan. Dutzende von Maharajas hatten ihm angehört, absolute Herrscher und unerschrockene Heerführer. Sie hatten ihre Juwelen, Schlösser, Frauen und Konkubinen kaum noch zählen können, zum Zeitvertreib Tiger gejagt und waren in prächtigen Rüstungen auf geschmückten Kriegselefanten in Schlachten gezogen.
Ohne ihre Familie und deren tausendjährige Geschichte war Laxmi nicht zu verstehen. Als sie mir am Anfang unserer Beziehung immer mehr zum Rätsel wurde und wir von einer Krise in die nächste rutschten, hatte ich Tage damit verbracht, die wechselhafte Historie der Singhs zu studieren. Da ich selber mit »edler« Abkunft gestraft war, hatte ich hier die Wurzel des Übels vermutet. Ich hatte richtig getippt: Nachdem ich Monarchen mit endlosen Namen und Titeln, labyrinthartigen Palästen, ständigen blutigen Fehden mit Feinden aus Persien, Afghanistan und den unzähligen indischen Staaten »kennengelernt« und über ihre zahllosen Frauen und Kindern den Kopf geschüttelt hatte – ein Urgroßvater Laxmis nannte noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 107 Frauen sein eigen! – verstand ich meine Schöne besser. Mir wurde vor allem klar, warum sie oft so extrem, so 125–prozentig war.
Читать дальше