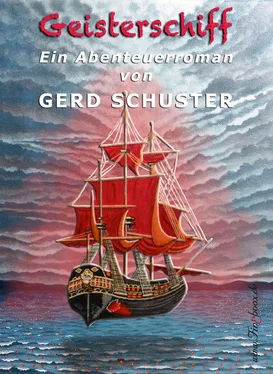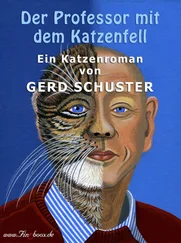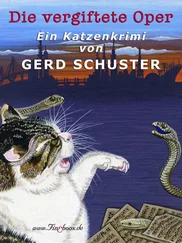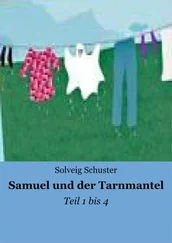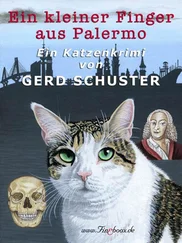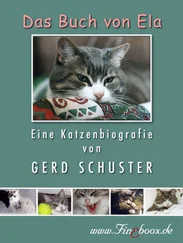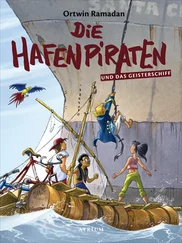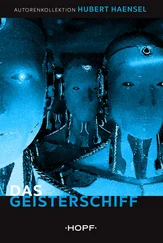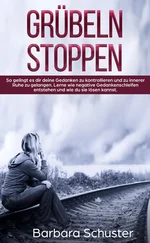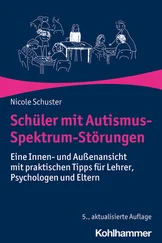Jedem Leser seien ein paar Stunden Internetrecherche im Reich der Singhs ans Herz gelegt. Eine kurze Einführung in die Singhsippe, die hier unverzichtbar ist, soll einen Vorgeschmack auf das geben, was den Surfer erwartet.
Maharajas waren keine Operetten–Majestäten. Weil in Rajasthan lange Zeit Krieg so alltäglich war wie Trockenheit in der Wüste Thar im Nordosten des Landes, waren die meisten Großkönige jung gestorben, und mancher Thronfolger hatte schon als Kleinkind die königlichen Weihen erhalten, weil sein Vater – der nicht selten bereits mit sechzehn Jahren einen Harem und Söhne besaß – auf dem »Feld der Ehre« geblieben war. Diesen wirklichkeitsfernen Namen gab man damals zerwühlten, mit Blut getränkten und mit Leichen bedeckten Landstrichen.
Die Sippe hatte neben all den früh vollendeten Monarchen auch einen hochgelehrten König hervorgebracht, der mit dem gleichen Eifer mathematische Probleme löste, wie er im Schlachtengetümmel gegnerische Helme zertrümmerte – Jai Singh II. Der Maharaja des Rajputenstaates Amber (Rajasthan existierte noch lange nicht) und spätere Erbauer von Jaipur lebte von 1688 bis 1743. Mit elf wurde er Großkönig, mit zwölf heiratete er seiner erste Frau, und mit dreizehn gewann er seine erste große Schlacht.
Im Dienste des verhassten Mogul–Kaiser Aurangzeb, dessen Vasall er gezwungenermaßen war, glänzte Jai Singh II noch häufig als Heerführer. Nachdem er 1701 – mit dreizehn – die Festung Vishalgarh erobert hatte, verlieh ihm Aurangzeb den Ehrentitel »Sawai«.
Damit erklärte ihn der moslemische Monarch, der die indischen Hindus wegen ihrer Religion besteuerte, den anderen Großkönigen um ein Viertel überlegen. Er machte ihn per kaiserlichem Dekret quasi zum Mister 125 Prozent. Wenn Maharaja Sawai Jai Singh II – so durfte er sich nennen – in die Schlacht ritt, führte er seitdem zwei Standarten mit – eine große und eine kleine, die das zusätzliche Viertel repräsentierte. Seine Nachfahren taten es ihm nach, und die Maharajas von Jaipur führen den Titel noch heute.
Obwohl der Mogul Jai Singh mit Verwaltungsaufgaben eindeckte und immer wieder in den Kampf schickte, leistete er auch als Mathematiker, Astronom und Stadtplaner Erstaunliches. So errichtete er in Delhi, Jaipur, Benares und anderen indischen Städten revolutionäre Observatorien, deren Instrumente, die von ihm selbst ersonnen waren, heute kaum noch jemand verstand.
Das fand ich äußerst bedauerlich, denn der Mann gefiel mir außerordentlich. Ich war überzeugt, dass Jai Singh II als einer der bedeutendsten Pioniere der Astronomie gewürdigt werden sollte. Die monumentalen astronomischen Instrumente des feinsinnigen Maharajas – eine seiner ovalen Sonnenuhren war rund 27 Meter hoch und 50 Meter breit – waren in der Lage, die Stellung der Planeten exakt zu ermitteln, ihre Umlaufzeiten auf eine Sekunde genau zu bestimmen und Sonnen– oder Mondfinsternisse vorauszusagen.
Der royale Astronom ließ neben anderer spektakulärer Hardware einen Planetenatlas anfertigen – eine Metallscheibe mit mehr als zwei Metern Durchmesser. Die wenigen Experten, die Singhs Instrumentarium erforscht haben, hielten seine astronomischen Messungen und Berechnungen für erheblich genauer als die des Ptolemäus oder anderen Sterngucker–Koryphäen des Altertums, wie den türkischen Hofastronomen Ulugh Beg.
Leider hatten die Nachfolger Jai Singhs kein Verständnis für Parallaxen, Azimut und komplizierte Bahnberechnungen und hielten die Wissenschaft ihres Ahnen für ein verschrobenes Hobby. Sein Enkel funktionierte das Observatorium in Jaipur in eine Fabrik für Feuerwaffen um und missbrauchte den genialen Planetenatlas seines Großvaters als Zielscheibe.
Mindestens ebenso beeindruckend wie Jai Singhs astronomische Pionierarbeit war der Luxus, mit dem sich die rajasthanischen Könige umgaben. Das Gepränge war unvorstellbar. Im Vergleich mit ihnen waren wir britischen Edelleute mit ganz wenigen Ausnahmen arme Schlucker, grobschlächtige Barbaren und dumpfköpfige Analphabeten.
Da hatte mein Vorfahr, der schottische Hauptmann Robert de Conyngham, sicher keine Ausnahme gemacht. Zwar hatte der kaum gebildete Rauhbautz, der mit seiner Scots Guard in der Leibgarde der französische Könige Charles VII und Louis XI diente, sich 1470 das Château de Cherveux erbaut. Aber während er sich in Herbst und Winter in dem zugigen grauen Gemäuer den Arsch abfror – wie der in Schottland gebliebene Familienzweig auf dem kargen Castle Cunninghame das ganze Jahr über –, lebten die Singhs schon seit tausend Jahren in riesigen luxuriösen, prunkvollen und klimatisierten Schlössern.
Das waren Wohnstädte mit Toren, die dem Ansturm von Kampfelefanten standhielten, gewaltigen Mauern, baumbestandenen Innenhöfen, Ziergärten und Hunderten von Gemächern, Sälen und Säulenhallen, die vor Kunst und Kultur überquollen. Die Wände bestanden nicht aus groben grauen Quadern, sondern meist aus kostbaren Einlegearbeiten – Arabesken aus diversen Halbedelsteinen – in hochglanzpoliertem weißem Marmor. Es gab Spiegelsäle, an vier Ketten aufgehängte Schaukelbetten, mit einem einzigen Pinselhaar auf Elfenbein gemalte Miniaturen und Pergamentrollen in einer Schrift, die man nur mit dem Mikroskop lesen konnte. Jedes Schwert und jeder Morgenstern, den die Maharajas in die Hand genommen hatten, war reich ziseliert und mit Einlegearbeiten bedeckt gewesen, ein Kleinod der Schmiedekunst.
Obwohl die Singhs mit ganz anderen Temperaturextremen zu kämpfen hatten wie meine schottischen Vorväter, mussten sie nicht schwitzen. Je nach Witterung pendelten sie zwischen ihren durch meterdicke Mauern gekühlten Hauptpalästen und ihren Alternativen hin und her – einem Schloss mitten in einem See und einem Monsun–Palais auf einem von frischem Wind gefächelten Berggipfel. Ihr Besuch residierte in einem gesonderten Gäste–Palast, dessen Glanz und Gloria die meisten Hauptsitze europäischer Herrscherhäuser in den Schatten stellten.
Da traf es sich gut, dass ich mir aus meinem ererbten Titel ohnehin nichts machte und den »Lord Cunningham, neunter Earl of Troon« nach Möglichkeit unter den Tisch fallen ließ. So musste ich mich angesichts der kulturellen Überlegenheit von Laxmis Familie nicht allzu sehr schämen und konnte sie neidlos anerkennen. Weil ich mich ungern schämte, verschwieg ich auch meine amtlichen Vornahmen Reginald Lucius Timothy Plantagenet. Ich frage Sie, geneigter Leser: Gab es angesichts dieses widerlichen Bombasts für mich eine Alternative, als einen gedeihlichen Vornamen wie Jim anzunehmen? Mir fiel einfach kein Grund ein, warum ich darauf stolz sein sollte, zufällig in eine Familie hineingeboren worden zu sein, die irgendwann von einem Monarchen – höchstwahrscheinlich einem ungebildeten und großkotzigen Leuteschinder, Mordbrenner und Kriegstreiber – geadelt worden war.
Deshalb ging mir auch das Gerede von Noblesse und blauem Blut gewaltig auf den Geist. Ein Titel machte aus einem schottischen Ackergaul noch lange keinen arabischen Vollblüter. Die Cunninghams sahen so wenig edel aus, dass man jeden von uns in eine abgewetzte Busschaffneruniform stecken konnte, ohne dass sich auch nur ein Fahrgast gewundert hätte. Im Gegensatz dazu war Laxmi durch und durch Aristokratin. Sie wirkte auch in Jeans wie eine Königin, und sie kämpfte wie ein Krieger der derben alten Rajputen.
So war sie auch für ihre Freiheit mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Sie hatte in London nicht, wie von ihrem Vater verlangt, Volkswirtschaft und internationales Management studiert, sondern Biochemie, Kriminalistik und klassische Musik. Als Instrument hatte sie sich ausgerechnet das Cembalo ausgesucht, das ihre Familie nur vom Hörensagen kannte!
Und genau wie ich strafte sie ihre amtlichen Namen mit Verachtung. Sie hieß, wenn man die Titel wegließ, Meenakshi Mirza Devraj Lalitya Kumari Singh. Dabei störte sie an ihrem Namen nicht nur der hochherrschaftliche Overkill. Sie hatte weitere Einwände: Jahrhunderte lang, sagte sie, habe das Haus Singh es für unnötig gehalten, in seinen veröffentlichten Familienchroniken die Namen der Töchter zu nennen – es waren ja nur Mädchen. Heirateten sie, wurden die Namen und Titel ihrer standesgemäßen Ehemänner in aller Ausführlichkeit genannt. Da verzichte sie gern.
Читать дальше