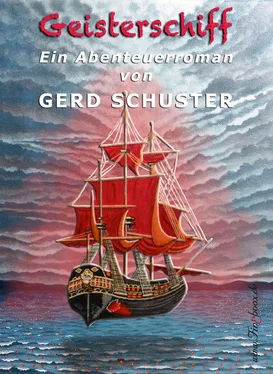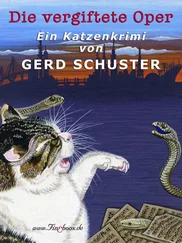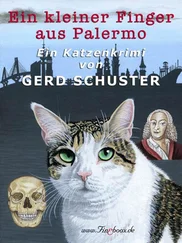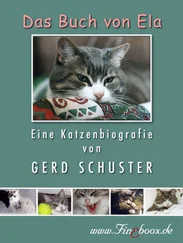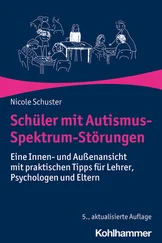Mit Laxmi hatte sie sich einen der häufigsten Namen ausgesucht, den arme Fischer und Bauern ihren Töchtern gaben. Sie hätte keine bessere Wahl treffen können; Laxmi war im Hinduismus die Göttin der Schönheit.
Mit der gleichen Konsequenz hatte meine Verlobte auch den für sie bestimmten blaublütigen Gatten zurückgewiesen – einen Sohn des Thakur of Isardar, wer immer das war.
Als die Singhs der aufmüpfigen Prinzessin den Geldhahn zudrehten, hatte Laxmi in London für ihren Lebensunterhalt gearbeitet. Sie hatte gekellnert und gemodelt, indische Ragas und Mantras mit Cembalo und Tabla statt mit der Sitar – oder mit Flöte, Tambura und Swarmandal – interpretiert und ein paar erfolgreiche CDs veröffentlicht. Und vor zwei Wochen ihren Doktor gemacht – in Biochemie. Es sah ganz so aus, als ob sie Jai Singh II nachschlug.
Wie Laxmi hatte auch ich mich gegen das Übermaß an staubiger Tradition aufgelehnt und darauf bestanden, mein eigenes Leben zu leben. Ich war von der Familie vor die Wahl gestellt worden, Diplomlandwirt zu werden und die Güter zu führen oder Jura zu studieren und in die Politik zu gehen. Weil ich beide Alternativen schauderhaft fand, war ich Berufssoldat geworden und hatte fünf Jahre in der Eliteeinheit Special Air Service gedient.
Nach einem Tauchunfall bei einer nächtlichen Kampfschwimmer–Übung in der Nordsee, der mich beinahe das Leben gekostet hatte, wechselte ich, obwohl genesen, auf Anraten der Militärpsychologen von der SAS zum Nachrichtendienst der Royal Navy. Ich machte den Job sieben Jahre lang und lernte viel, das ich als Ermittler gut gebrauchen konnte.
Es war nicht einfach, mit Laxmi zusammenzuleben, aber es würde mit ihr, das war klar, niemals langweilig werden. Man wusste nie, ob sie kämpfen oder sich hingeben wollte, und wenn man falsch lag, explodierte sie mitunter wie der Vulkan von Krakatoa. Ihr Sinn für Gerechtigkeit und ihre Abscheu vor jeder Unterdrückung und Knechtung von Frauen führten außerdem zu endlosen Diskussionen. Auch wenn ich ihr Recht gab und nur ein paar allzu extreme Ansichten von ihr zu relativieren suchte, fiel sie häufig über mich her, als sei ich verantwortlich für alles, was Männer auf dieser Welt angerichtet haben. Aber wir liebten uns – mehr, als wir uns derzeit sahen und berührten.
Es war gut, dass Laxmis Eigenheiten für mich »transparent« geworden waren, und dass ich erkannt hatte, dass das schwere Erbe der einundvierzig Singh–Maharajas, die ihre Dynastie seit 966 hervorgebracht hatte, sie ebenso prägte wie ihre Erziehung und ihre herbe Heimat; denn sie war mein großer Trumpf in dem ständigen Kräftemessen mit Hamish Hogg von Waters, Windermere und Winchester.
WW&W war meine gefährlichste Konkurrenz. Hogg war ihr dickster Trumpf, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er war nicht nur mir allen Wassern gewaschen, sondern in groteskem Maße fett – wobei das Adjektiv fett entscheidend zu harmlos ist für seine monströse Masse.
Trotz seiner hinderlichen Fülle war Hogg ein unbequemer Gegner. Er war gerissen und konnte zudem über die Infrastruktur einer großen Sozietät verfügen, während ich nur Laxmi und mich hatte. Kaum einer in der Branche wusste, dass meine Agentur, die den stolzen Namen »Maritime Investigation Agency« (MIA) trug, nur aus zwei Mitarbeitern sowie der Telefondame Cheryl und dem Kater Admiral Nelson bestand. Die dralle Cheryl sorgte im Büro für Erreichbarkeit wenn Laxmi im Labor forschte und ich – oder wir beide – verreist waren.
Ich glaube nicht, dass Lloyds, für die ich als »fester freier« Ermittler arbeitete, die dünne Personaldecke von MIA gefallen hätte. Versicherungen haben immer Bedenken, denn davon leben sie. Aber mehr als an allem anderen war man an Resultaten interessiert. Wer diese lieferte, bekam die ausgelobte Erfolgsprämie gezahlt, seine Spesen erstattet, ein paar anerkennende Klapse auf den Rücken und den nächsten Auftrag.
Ob man seinen Job alleine oder mit fünfzig Hilfskräften erledigte kümmerte Lloyds einen feuchten Kehricht.
Wie gesagt: Hogg war ein unerquicklicher Konkurrent. Um ein Haar hätte er mir ein paar Erfolge direkt vor der Nase weggeschnappt. Wenn Laxmi nicht gewesen wäre, hätte er nicht nur das Schicksal der drei spanischen Fischdampfer geklärt, die ein russisches Atom–U–Boot in ihren Netzen »gefangen« hatten und von ihm im Skaggerak unter Wasser gezogen worden waren, sondern auch das Schicksal des westlich von Sri Lanka von Piraten gekaperten und in Nigeria verkauften voll beladenen Öltankers und zwei oder drei andere Sachen.
Beim Aufspüren der in Dubai von der Russenmafia gestohlenen und im Hafen der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer versteckten Luxusjacht eines milliardenschweren Emirs hatte ich ihn gerade mal um eine knappe Viertelstunde geschlagen. Und das auch nur, weil er Pech gehabt hatte: Sein Taxifahrer hatte ihn wegen seines gewaltigen Körperumfangs für einen amerikanischen Touristen gehalten und ihn in der Hoffnung auf ein dickes Trinkgeld eigenmächtig zuerst zum Geburtshaus von Anton Tschechow gefahren statt auf dem schnellsten Weg zu der Werfthalle, wo das 40– Millionen–Dollar–Spielzeug gerade umgemalt wurde.
Wie Hogg es anstellte, wusste ich nicht. Er war eigentlich viel zu dick für seinen Beruf, aber er hatte die Nase, auf die es ankam. Wenn er keine übersinnlichen Begabungen besaß wie ich, war er verdammt gut.
Als Gegner achtete ich Hogg, obwohl er mir Schwierigkeiten machte; denn das geboten mir Fair Play und Ritterlichkeit – eine altmodische Familientradition, der ich mich verpflichtet fühlte. Als Mensch fand ich den Kollegen jedoch überaus widerwärtig.
Ich vermeide es prinzipiell, Mitbewerber anzuschwärzen, weil das billig und stillos ist. Bei Hogg war diese Zurückhaltung aber unnötig. Es genügte völlig, ihn einfach nur zu beschreiben.
Der Mann von WW&W war mit seinen rund vier Zentnern nicht nur so stark überfüttert, dass man befürchten musste, sein Organismus könne der Belastung nicht länger standhalten und bersten; er platzte auch vor Arroganz. Er beschämte, was Eitelkeit anging, jeden rajasthanischen Pfau.
Ein kurzer Blick in sein Gesicht genügte, und ich geriet in Gefahr, kurzzeitig all den Benimm zu vergessen, den man mir zu Hause, in Eton und in Cambridge eingebimst hatte. Er war einfach unerträglich! Hoggs feiste Oberlider, Turbo–Mastschwein–rosa gefärbt wie alles an ihm, hingen dank ihrer Schwere so weit herunter, dass sie das obere Drittel seiner Iris verdeckten. In Verbindung mit der geckenhaften Brille, die winzige quadratische Gläser hatte und in seinem breitflächigen Gesicht wirkte wie ein Stückchen verirrten silbernen Weihnachtsflitters auf dem Festtagstruthahn, verlieh ihm das einen dünkelhaften und selbstherrlichen Ausdruck. Seine Umwelt, so hatte es den Anschein, langweilte ihn zu Tode.
Doch bei aller scheinbaren Schläfrigkeit lauerte er immer auf Informationen. Er war wie ein Krokodil, das in den trüben Fluten eines afrikanischen Flusses auf Beute wartete.
Das eitle Ekel und das Krokodil waren aber nur zwei von Hoggs Inkarnationen – angesichts seiner Fleischmassen machte das Wort wirklich Sinn! Wenn es ihm angezeigt erschien, verfiel er aus seinem pseudo-aristokratischen Überlegenheitsgetue und seiner alligatorenhaften Schläfrigkeit in eine kaum weniger unangenehme schmierige Art. Er gab sich kumpelhaft, zeigte grienend seine großen, in auffälliger Weise vereinzelt stehenden Zähne, überschlug sich vor Servilität, redete seinem Gegenüber nach dem Mund und rieb dabei seine schwitzigen Hände wie ein levantinischer Gewürzhändler.
Ich fiel auf die Komödie schon lange nicht mehr herein. Ich wusste, dass er eine Hyäne war – sicher die einzige fette, die es in der freien Wildbahn gab.
Au! Ich zuckte zusammen. Meine linke Fußsohle war plötzlich höllisch heiß geworden. Es war, als befände sich ein glühendes Bügeleisen in meinem Schuh. Ich krümmte mich in den Sitzgurten zusammen, um meinen Fuß zu packen und den Schuh herunterzureißen. Es war eine törichte Reaktion, denn da brannte ja nicht wirklich etwas. Es handelte sich um eine irrlichternde Empfindung, die rasch verging; aber der Reflex war unausrottbar. Und so war es auch dieses Mal: Kaum hatte ich den Fuß gepackt, hörte das Brennen auf.
Читать дальше