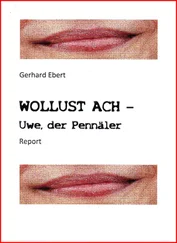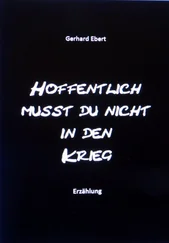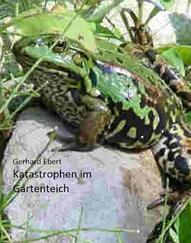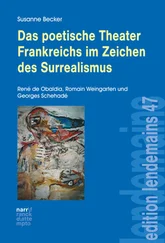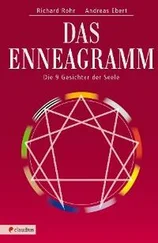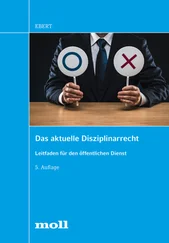Je unfähiger sich indessen die Führung der DDR erwies, die Widersprüche des neuartigen antikapitalistischen Systems zu lösen und demzufolge Verkrustungen und Verstörungen zunahmen und das Land schließlich regelrecht stagnierte, desto komplizierter wurde die Situation für das Theater. Seine Funktion, den Zuschauer zu ergötzen, kaum begriffen und noch kaum erblüht, erwies sich als utopisch und verkümmerte. Die Künstler griffen zurück auf alte erprobte Mittel, schockierten ihre Zuschauer wieder im Sinne eines kritischen, schließlich eines verstörenden Realismus. Symptomatisch dafür der Weg von Bertolt Brecht zu Heiner Müller. Zuversicht und Vertrauen bei Brecht, das Tor zu einer neuen, menschenwürdigeren Gesellschaft in Deutschland aufgestoßen zu wissen, und schließlich Wut, Ohnmacht und Verzweiflung bei Müller über das offenbare Scheitern des historisch ersten Versuchs, auf deutschem Boden eine humanistische sozialistische Gesellschaft zu errichten.
Knapp vier Jahrzehnte dieses Theaters eines wahrhaft historischen Aufbruchs hat der Autor vorliegender Publikation von 1955 bis 1990 theaterkritisch begleitet, zunächst als junger Redakteur des „SONNTAG“, dann als freier Mitarbeiter der Zeitungen „Theater der Zeit“, „Junge Welt“ und „Neues Deutschland“. Dabei hat er sich - stets auch selbst auf der Suche - mehr oder weniger glücklich an den Maßgaben Brechts orientiert und sieht keinen Grund, dies zu verleugnen. Vergnügung als nobelste Funktion des Theaters, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern als ein Ereignis unterhaltsamen Leben-Lernens, als ästhetische Hilfe bei der Vermenschlichung der Gesellschaft wie jedes einzelnen Bürgers bleibt die Hoffnung.
Ein wenig fragwürdig allerdings lesen sich aus heutiger Sicht die in meinen Kritiken zuweilen nassforsch postulierten Bezüge zur Gesellschaft und der diesen Kritiken innewohnende unbedingte Glaube an den neuen deutschen Staat und die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Da obwaltete eine doktrinäre schwarz-weiß Mentalität insbesondere in der Beurteilung der BRD, wie sie umgekehrt heutzutage freilich auch bezüglich der untergegangenen DDR zu beobachten ist.
Wie auch immer: Unverwechselbare künstlerische Leistungen sind und bleiben historische Tatsache als Bestandteil deutscher Theatergeschichte nach der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands. Nachkommenden dokumentarisches Material an die Hand zu geben, um ihnen eine differenzierte und lebenswahre Sicht zu ermöglichen, scheint dringend geboten.
Berlin 2014
Gerhard Ebert
„Der gute Mensch von Sezuan“
von Bertolt Brecht,
DDR-Erstaufführung am Volkstheater Rostock,
Regie Benno Besson
Der Engel der Vorstädte
Mit der DDR-Erstaufführung des Parabelstückes „Der gute Mensch von Sezuan" von Bertolt Brecht hat sich das Volkstheater Rostock in die erste Reihe der Theater unserer Republik gespielt. Noch wichtiger ist: Brechts episches Theater, das Theater der nackten Erkenntnis, hat bei einem Publikum gesiegt, das zum ersten Male die desillusionierende Theaterkunst Brechts erleben konnte; erleben freilich nicht im althergebrachten Sinne, sondern eben im Sinne des bewußten, des betrachtenden Erlebens.
Einfach ist Brechts Parabel. Shen Te, ein armes Menschenkind in der Provinz Sezuan des vorrevolutionären Chinas, eine Prostituierte aus Not, beherbergt drei Götter, die auf die Erde gekommen sind, um gute Menschen zu suchen. Weil Shen Te ein guter Mensch ist, schenken ihr die Götter tausend Silberdollar. Für das Geld kauft sich Shen Te einen kleinen Tabakladen. Bald muß sie feststellen, daß man vom „Gut sein" in einer Ausbeutergesellschaft nicht leben kann, daß man vielmehr unter die Räder kommt. Shen Te jedoch will leben. Sie verkleidet sich als Vetter Shui Ta und läßt die armen Menschen für sich arbeiten. Doch die ausgebeutete Menge meint, Shui Ta habe Shen Te, den Engel der Vorstädte, ermordet, um sich deren Eigentum anzueignen. Man bringt Shui Ta vor Gericht, und dort enthüllt Shen Te die grausame Wahrheit: Der böse Shui Ta ist Shen Te, der gute Mensch von Sezuan! Shen Te ruft die Götter um Hilfe an, aber die ziehen sich in ihr Nichts zurück.
Brecht schließt in einem Epilog mit der Aufforderung ans Publikum, überall dort die Gesellschaftsordnung zu ändern, wo — wie einst in China — ein guter Mensch böse werden muß, um leben zu können.
Benno Besson, der Gastregisseur vom Berliner Ensemble, hat in Käthe Reichel, der „Grusche" der „Kreidekreis"-Inszenierung in Frankfurt (Main), eine überragende Darstellerin der Doppelrolle Shen Te/Shui Ta gefunden. Käthe Reichels Spiel als Shen Te ist von bestrickender Herzlichkeit, Natürlichkeit und Wärme und zugleich von einer hinreißenden schauspielerischen Intensität, gar nicht verfremdet im Sinne Brechts, sondern zutiefst durchlebt. Käthe Reichel ist eine überragende Sprecherin Brechtscher Verse, sie führte die Aufführung zum Sieg, und neben ihr zu bestehen, war für ihre Mitspieler nicht leicht. Erfreulich daher, daß das Ensemble trotz der ungewohnten Aufgabe mit ihr wuchs, so daß — abgesehen von einigen sprachlichen Mängeln — von einer geschlossenen Ensembleleistung gesprochen werden muß.
Wochenpost, 28. Januar 1956
von Heiner Müller,
Uraufführung am Schauspielhaus Leipzig,
Regie Günter Schwarzlose
Neue Stücke - neue Probleme
In einer Studio-Inszenierung wurde Heiner Müllers Szenenfolge „Der Lohndrücker" nun endlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Aufführung ist eine beachtliche Ensembleleistung der Leipziger Künstler, die Müllers „Lohndrücker" (und Baierls „Feststellung") neben der normalen Probenarbeit einstudierten. Daß dabei ein echter Theaterabend zustande kam, soll hier vorweggenommen und dafür plädiert werden, beide Stücke schleunigst in den Abendspielplan aufzunehmen.
Feststand, daß die Erprobung des Stückes wichtige Aufschlüsse geben würde über die neue Dramatik, ihre Darstellung und ihre Publikumswirksamkeit. Wenn nun die Kritik herausfinden sollte, Theaterstücke wie „Der Lohndrücker", welche die Exposition des Konfliktes, seine Entwicklung, Austragung und Lösung nur in filmartig aufblendenden Szenen und Szenchen liefern, seien wegweisend für die neue Dramatik, muß sie damit rechnen, daß flinke Ästheten sehr bald eine passende Theorie zur Hand haben, vor der dann die Dramatiker sitzen wie die Kaninchen vor dem Licht. Sie muß sich das also gut überlegen.
Selbst bei den günstigen Leipziger Bühnenverhältnissen wurde offenkundig, daß dieses Stück enorme Anforderungen an die Technik stellt. (Das Bühnenbild wurde im Hinblick auf Gastspiele relativ praktisch gebaut von Harald Reichert.) Aber das interessiert erst in zweiter Linie. Wichtiger ist: Da Müller die Aussage jeder einzelnen Szene geradezu wie mit Zeitraffer und Lupe komprimiert, so daß der Inhalt seine knappe, verdichtete Form fast zu sprengen scheint, eine Qualität, die vom Darsteller wie vom Zuschauer Konzentration auf den wesentlichen Vorgang erzwingt, gibt er sozusagen nur die markanten Drehpunkte seiner Handlung. Dem jungen Regisseur Günter Schwarzlose ist es zwar gelungen, nahezu jeder Szene jene Dichte, jene drangvolle Gewichtigkeit zu verleihen, die der Text verlangt, und gleichzeitig den Handlungsbogen durchzuhalten beziehungsweise sichtbar zu machen (die Realisierung des Stückes auf der Bühne ist also möglich), aber er kann nicht verhindern, daß die zahlreichen Pausen Aufmerksamkeit absorbieren. Der Autor sollte sich auf spezifisch dramatische Gestaltungsprinzipien besinnen und die Erneuerung des Theaters nicht durch eine Art abgewandelte Filmtechnik suchen. Hier liegt eine gewisse Gefahr, die verknappende, ungestische Behandlung des Konfliktes zur Manier zu machen.
Der neue Inhalt macht das Stück schon heute zu einem theatergeschichtlichen Ereignis. Die Pionierarbeit von Karl Grünberg und Hermann-Werner Kubsch in den ersten Jahren unseres Aufbaus, ihr Vorstoß zu neuen Inhalten in der Dramatik ist nicht vergessen. Aber was damals noch nicht mehr als ein Versuch werden konnte, das ist heute, einige Jahre danach, das sozial realistische Abbild eines bestimmten Abschnittes unserer Entwicklung, aus der Erfahrung gestaltet und deshalb gültiger in seiner künstlerischen Aussage.
Читать дальше