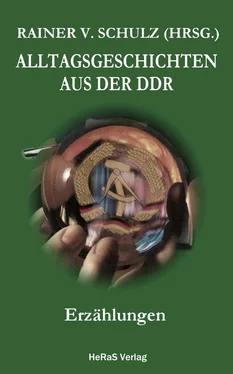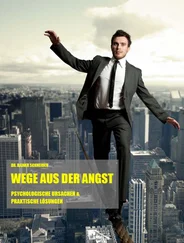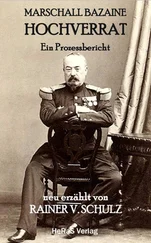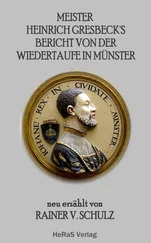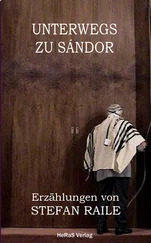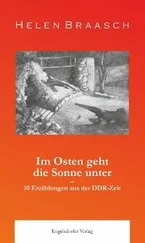Mugele geniert sich wegen des offen bekundeten Desinteresses, das schon beleidigend ist. Nach dem so ergebnislos verlaufenen Disput sagt Professor Ziegler. „Konstantin, es ist nicht so wie es ist.“ – Merkwürdiges Trostwort. Noch zu Haus geht es Mugele durch den Kopf. Wie sollte es anders sein als es ist?
Koko ist ihm zur Begrüßung auf die Schulter geflogen und will gekrault sein, heute ein wenig nur. Schon hört er auf, zärtlich zu sein. Mugele verweist ihn auf seine Schaukel. In Wirtschaft und im Militärwesen, überlegt Mugele, bei Staat und Recht, bei der Industrie, selbst im Sport, überall sind Fachleute gefordert – bei Künsten und Kulturpolitik? Jeder der Mächtigen redet mit, das ist schon in Ordnung. Aber jeder entscheidet auch, freilich nach persönlichem Geschmack, ob ein pikanter sowjetischer Spielfilm, der im ganzen Land läuft, auch in Leipzig gezeigt wird, oder was sich zu Bernau ein Leierkastenmann herausnimmt, auf seiner Drehorgel abzunudeln. Nun Kommission, erleuchte mal. Dabei kann sich der Kommissionsleiter nicht von den eigenen Prägungen freimachen.
Die Theoretiker in der Hauptstadt empfehlen den Autoren plötzlich, sich die Sicht der Königsebene zu erarbeiten. War bislang der Blick von unten gefragt, ja gefordert, zu gestalten, was die Künstler an der Basis, in Betrieben und Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gesehen und erlebt hatten, war nun mit den neuen Werken, die zu Tage traten, ob der Genauigkeit der Spiegelung der Schrecken groß. Selbst der Dichter KuBa wird wegen seines Theaterstücks Bauernkantate angezählt: er liebe die Bauern nicht. Das behauptet Genosse Ernst Wulf, Vorsitzender einer mecklenburgischen Muster-LPG. Er sagt es auf dem ZK-Plenum, das den Bauernkongress bewertet. Das lässt der dickköpfige Dichter nicht auf sich sitzen, und reicht dem Muster-LPG-Vorsitzenden sein Skript:
„Da, lies erst mal und streich an, womit du deine Behauptung begründen könntest.“ Und vor dem Gremium verlangt er eine Analyse des Stücks, und die wird ihm zugesagt. Aber die versammelten Funktionäre, obwohl manche von ihnen die Bauernkantate in Rostock-Marienehe gesehen hatten, können sie ihm nicht bieten. Der inkommodierte Schriftstellerverband vermag es auch nicht, selbst die unglücklich bemühte Akademie der Künste kommt mit dem Stück nicht zurande, findet zu keiner Verurteilung, und eine Analyse hat sie auch nicht. Und ging es überhaupt um Liebe? – Ein Dichter hat seinen Zeitgenossen den Spiegel vors Gesicht gehalten! Nun soll die Kommission für Erleuchtung den Fall abschließen. Der Vorsitzende lädt die berufenen Kommissionsmitglieder erst gar nicht ein, sondern nimmt die Angelegenheit selbst in die Hand, stößt aber auf beharrlichen Widerspruch des Dramatikers. Besessen, wie Shylock sein Pfund Fleisch verlangt, fordert der: „Versprochen ist eine Analyse des Stücks. Ich will die Analyse haben.“ Lautstark. Bis der Professor entnervt resümiert: „Jedes Ding muss doch ein Ende finden, Genosse KuBa. Man muss auch mal eine Kröte runterschlucken.“
„Wenn du das kannst, Kröten schlucken“, sagt der, „dann schluck. Ich kann es nicht.“
Männerstolz vor Königsthronen? Konstantin ist es von KuBa gewohnt. Und er bewundert ihn. Er selber – ein Lernender. Aufmerksam genug? Gut zwei Jahre ist er jetzt beim Ziegler. Den Professor sieht er kritischer als zuvor.
Der Alte macht aber auch Fehler. Statt angesichts der notorisch geist- und literaturfeindlichen Attacken der Adenauer, von Brentano und Erhard gegen die Schriftsteller eine Bresche für mehr Libertät, mehr Experimentierfreude einzufordern, kommt er dem versammelten Sekretariat mit Marxens Philosophisch-Ökonomischen Manuskripten. Die hat der geschrieben, so was weiß man doch, da war Marx noch gar nicht Marxist.
Der Alte gilt als einfühlsam, wenn er mit jungen Schriftstellern über deren Manuskript disputiert, denkt Mugele, aber wenn er dabei auf eine Textstelle trifft, die er als feindlich empfindet, wird er urplötzlich kiesig. „Du bist verantwortlich für das, was aus dir herausquillt.“ Er beginnt also, mit Fritzing Reuter gesagt, herut zu untersäuken. „Wie kommt so was in deine Feder? In dir muss es doch stecken, wie käme es sonst heraus?“ Und das sagt einer, der frei spricht, anregende Gedanken vorbringt und manchmal Hanebüchenes.
Statt mit dem Werk des viel zu früh verstorbenen Bertolt Brecht zu wuchern, der sich als kommunistischer Künstler die DDR erwählt hatte, um gegen die Alte Welt anzutreten, und nicht eben ein bürgerlich-antifaschistischer Mitstreiter war, verhält sich Ziegler wie alle Moskowiter in der Parteiführung, zaudernd. Aber wie Brecht ist Ziegler der Meinung, dass die Bibel in den Schulstoff gehört. Und ganz praktisch: Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden – spar sie dir, wenn du keine Ahnung vom Alten Testament hast. Mugele hat Ahnung. Das mit der Bibel plaudert Konstantin, da ist er gern Papagei, bei den jungen Dichtern aus.
Was zwischen den Kontrahenten an Ressentiments lief – da bist du zu jung zu, Mugele, das kriegst du nicht raus. Und überhaupt ist 1961 ein Jahr, da weiß niemand so recht, was die Weltgeschichte bereithält - Jahr des Eisenbüffels. In einer Kapsel umkreist der erste Mensch den Erdball, die Vereinigten Staaten zeigen sich tief getroffen. Im Fernsehen: Eichmann im Glaskasten. Hat immer nur seine Pflicht getan. Die Chruschtschow-Note zur Entmilitarisierung Westberlins mahnt an, bis Weihnachten solle der Hort der Freiheit Freie Stadt werden, ohne Geheimdienste, ohne Besatzer. Die Welt schreckt auf. Es kommt keine Ruhe in den Sommer, wiewohl alles läuft, wie es läuft.
Am Müggelsee gibt es ein kleines Sommerfest. Professor Ziegler ist entspannt und fröhlich. Die Urlaubsreise in den Kaukasus ist unter Dach und Fach, beschlossen also. Arme Personenschützer, an den Bergen wird euch der Alte davonklettern. In heiterer Laune auch Otto Gotsche, Sekretär Walter Ulbrichts, schlendert am Tisch Zieglers entlang und sagt: „Bernhard, ich glaube, dass du zeitlebens ein Wandervogel geblieben bist.“
Wieder ein Sonnabendnachmittag. Vom Ho hen Haus fährt ein Bus mit den Abteilungsleitern in den Niederbarnim. Es wird kein Ausflug in die Sommerfrische. Am südlichen Eingang der Gemeinde Basdorf biegt der Bus in das Objekt der Kasernierten Bereitschaftspolizei ein . Der Kommandeur wartet schon am Eingang. Er führt die Gäste in die Problematik ein : Schnell mit voller Kampfstärke das Objekt verlassen und Kampfpositionen einnehmen. Er zieht die Stoppuhr, löst Alarm aus. Ein gemächlicher Tag bricht weg, wird Geschrei, Geknatter und Rauch. Mögen einstmals Ritter, Knappen und Knechte bei Gefahr zur Burg gestürzt sein – hier eilen bewaffnete Männer, sich hastig den Rock knöpfend, zu Schützenpanzern und Mannschaftswagen, um aufs Rascheste die Burg zu verlassen. Motoren heulen auf. In einer Staubwolke verschwindet ein Bataillon. Der Kommandeur blickt auf die Stoppuhr: „Sechs Minuten. Das geht“, verkündet er stolz. Es gibt nachdenkliche Gesichter. Mugele denkt sich nichts Böses, hat sich den versauten Nachmittag auch nicht gewünscht, fragt also: „Genosse Kommandeur, was kostet der Probealarm?“
Der Offizier, den Unwillen einiger nicht beachtend, antwortet er doch dem Hohen Haus , rechnet, überschlägt die Einzelposten, sagt: „Die heutige Übung kostet etwa 26 000 Mark der Deutschen Notenbank.“ Nun sind es alle zufrieden. Konstantin versteht nicht.
Auch Irene D., eine Freundin, ist verwundert. Sie ist Slawistikstudentin an der Humboldt-Universität. Hat ein Praktikum am Frauensee in der Dubrow, 30 Kilometer südlich von Berlin. Ein Ferienlager ist zu betreuen mit deutschen Kindern, mit russischen Kindern aus den Waldsiedlungen in der Sperrzone. Deutsche und russische Kinder kommen bald gut miteinander aus, spielen, singen, tanzen. Die schön gebundenen Haarschleifen der russischen Mädchen werden bewundert und stören nicht, nur beim Baden. Alle tummeln sich, an 14 Tage ist gedacht, am Strand des Frauensees. Wo es Verständigungsschwierigkeit gibt – Irene behebt sie. Zum Mittagessen verlangen die russischen Jungpioniere Chleb – und die Küchenfrauen, den Brauch nicht gewohnt, schaffen Brot herbei und schneiden es zurecht. Soll ein wunderschöner Kindersommer werden. Bis eine russische Offiziersfrau im Wolga vorgefahren kommt, um ihren Pjotr in einer Familienangelegenheit aus dem Lager zu holen. Da hilft kein Gezeter des Jungen. Eine andere Offiziersfrau eilt auf dem Fahrrad herbei, Jewgenia müsse ihr nun doch im Garten helfen . Hilft keine Träne. Eine dritte, vierte russische Mutter, mal ein Vater in Hauptmannsuniform, verlangen ihr Kind zurück, bedanken sich artig und murmeln irgendwas. Binnen zweier Tage leert sich der russische Part des deutsch-sowjetischen Ferienlagers. Irene versteht nicht.
Читать дальше