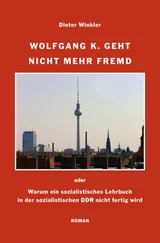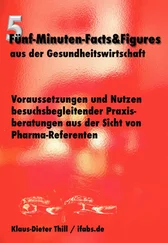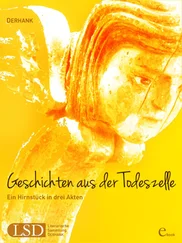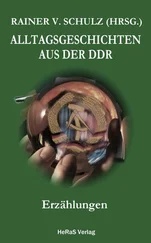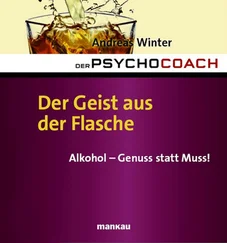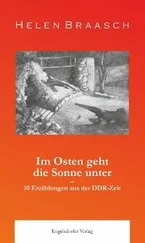Dieter Winkler
DDR aus der Schublade
Aufzeichnungen eines Ostdeutschen
aus über fünf Jahrzehnten
Impressum
DDR aus der Schublade
Copyright: © 2014 Dieter Winkler
Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN-Nr. 978-3-8442-9358-6
Lektorat: Iris van Beek, Ulrich Schweizer
Inhalt
1. Vorwort
2. Die Sechziger
2.1 Arbeiter
2.2 Student
2.3 Absolvent
2.4 Gedicht-Versuche (um 1970)
3. Honeckerjahre
3.1 Randbemerkungen I
3.2 Aus meinem Leben
3.3 Aus der Bürokratie
4. Wendezeit
5. „Ossi“
5.1 Randbemerkungen II
5.2 Randgespräche
5.3 Minigedichte
5.4 Die Zukunft der Rente – eine Selbstverständigung
6. Anhang
6.1 Rundtischgespräch im „Sonntag“ 1975
6.2 Promotionsverfahren an der Humboldt-Universität zu Berlin 1993/94
Weil eine radikale Kritik an der Gesellschaft der DDR in der DDR selbst öffentlich kaum äußerbar war, schrieb man sie nicht selten auf. In der DDR entstand in den 40 Jahren ihrer Existenz eine Vielzahl höchst unterschiedlicher sogenannter Schubladentexte, die seit 1990 Band für Band an eine auf sie nicht gerade neugierige Öffentlichkeit drängen. Als eine Quelle für das wirkliche Denken und Handeln zumindest eines Teils der ostdeutschen Bevölkerung machen diese Texte jedoch deutlich, dass unter einer autoritär verkrusteten Oberfläche immer mehr an geistiger Bewegung stattfand, als für Blicke von außen erkennbar war.
Zu den Autoren solcher Schubladentexte hatte ich gehört. Darauf weisen bereits die gemeinsam mit Torsten Hilse herausgegebenen vier Bände „Schubladentexte aus der DDR“. Wenig hatte mich dabei das Verfassen umfangreicher Traktate gereizt – bei mir hatten Erlebnisse, Ereignisse und Lektüre immer wieder und vor allem zu bitteren oder boshaften, lapidaren oder vergleichenden Kurzkommentaren geführt, die ich später „Randbemerkungen“ nannte. An denen habe ich vom ersten Einfall bis zur letzten Fassung zumeist mehrere Tage formuliert, gelegentlich sogar noch länger: unterwegs auf der Straße, in langweiligen Zuhörveranstaltungen, abends am Schreibtisch. Dort, wo mir aus dem Einfall keine mich einigermaßen oder mehr befriedigende Textfassung geriet, warf ich die Sache wieder weg. Darum sind – von Ausnahmen abgesehen – nur meine Aufzeichnungen aus den Sechzigern ein echtes Tagebuch.
Wichtiger als die Form meiner Notizen ist etwas anderes: Bei meinen „Aufzeichnungen eines Ostdeutschen aus über fünf Jahrzehnten“ handelt es sich um Texte eines vor und nach dem Epochenbruch von 1989/90 Nichtprominenten – eines Menschen also, den die Umstände dazu brachten, den ehemals zweiten deutschen Staat, aber auch dessen „Aufarbeitung“ nach seinem Untergang, von „unten“ zu betrachten. Außerdem gehöre ich zu den Ostdeutschen, die in der DDR erlernte Verhaltensmuster auch nach dem Ende der DDR nicht mehr abgelegt haben. So begann auch nach 1990 meine Reaktion auf nunmehrige Regierungs- u. a. Verlautbarungen in der Regel weiterhin mit der Frage: Was spricht dagegen? War ich doch auch im Westen schon sehr bald auf neue Behauptungen von hoher Ideologiehaltigkeit und geringem Realitätsgehalt gestoßen: Wie etwa der, dass die größere soziale Ungleichheit im Westen der „Preis der Freiheit“ wäre. Als ob im Chile des demokratisch-sozialistischen Präsidenten Allende mehr an sozialer Ungleichheit geherrscht hätte als unter der wirtschaftlich und sozial neoliberal ausgerichteten Diktatur des Generals Pinochet.
Auch stieß ich, wie z.B. meine zweite Anlage beweist, in der neu erworbenen westdeutschen Gesellschaft auf so manche Erscheinungen, die mich ziemlich fatal an unangenehme Realitäten von ehedem erinnerten. Aus einem langjährig kritischen DDR-Bürger konnte so nur ein höchst kritischer Bundesbürger entstehen.
Wer bin ich?
Noch mitten im II. Weltkrieg in Leipzig geboren, gehören zu meinen prägenden Kindheitserfahrungen ein fehlender, weil an der Front gefallener Vater, Ruinen auf Schritt und Tritt, der Hunger in den ersten Friedensjahren – aber auch die Erzählungen meiner Großmutter, bei der ich aufwuchs, und anderer Verwandter und Bekannter über das Elend während Inflation und Weltwirtschaftskrise.
Natürlich sind Teil meiner Kindheitserfahrungen auch Kommunisten. Sie waren nicht alle Machthaber und nicht alle synchron mit ihrer Führung denkend und handelnd. Mein Stiefvater, dem als gelernten Zimmermann die Sprache des Proletariats vertraut war, gab mir z. B. nach dem XX. KPdSU-Parteitag 1956 die Lehre mit auf den Weg: „Politikern darfst du nie allein aufs Maul schauen. Sondern musst du stets auch auf die Pfoten gucken. Das gilt auch für die eigenen Leute.“ 1)An meinen Schulen stieß ich auf Lehrer, die auf Grund eigener politischer Irrungen in ihrer Jugend ihren Schülern ebenfalls ein gewisses Maß an politischem Irrtum zugestanden: Meine Oberschule mussten während meiner vier Jahre dort 2)nur Schüler mit nicht ausreichenden fachlichen Leistungen wieder verlassen. Allerdings hörte ich von anderswo durchaus auch anderes.
Eines einte alle Kommunisten, auf die ich damals stieß: Die Überzeugung, in Ostdeutschland eine „bessere Gesellschaft“ – ohne Krieg und Wirtschaftskrisen und mit Aufstiegschancen auch für Kinder aus der „Arbeiterklasse“ – „errichten“ zu können. Wer im festen Glauben an die „Sieghaftigkeit“ der kommunistischen Sache die Verfolgungen der Nazi-Diktatur überlebt hatte, nahm damals allzu gern an, dass seine „Sache“ auch „noch nicht Überzeugte“ über kurz oder lang zu gleichen historischen Einsichten wie ihn selbst bringen müsse. Mich machte jedoch etwas anderes zum jungen Kommunisten: Im Kinderferienlager 1955 an der Ostsee hatte ein gleichaltriges westdeutsches Mädchen meine Hand ein wenig zu lange in die ihre gelegt. Danach war ich von der Richtigkeit der seinerzeitigen Wiedervereinigungsprogrammatik der SED zutiefst überzeugt. Mein nunmehr staatstreuer Aktivismus hat mir allerdings so manchen Ärger bei Mitschülern eingebracht. Woanders konnte sich solcher „Ärger“ Mitte der fünfziger Jahre sogar noch bis hin zu „Klassenkeile“ ausweiten.
Obwohl ich an meiner Oberschule zu den da ziemlich raren engagierten Anhängern des Staates unter den Schülern gehört hatte, schickte mich die Universität nach dem Abitur in einen Leipziger Großbetrieb, um mir dort noch mehr „Bewusstsein der Arbeiterklasse“ anzueignen. Diesen zwei Jahren in der „materiellen Produktion“, im Gorki’schen Sinne ebenfalls „Universitäten“, entstammt die zweite Generation der mich prägenden politischen Erfahrungen.
Als ich im Sommer 1962 mein Arbeiterleben beendete, wusste ich, dass das uns Ostdeutschen nach dem Sieg der Sowjetunion im II. Weltkrieg übergestülpte sowjetisch-stalinistische Modell von „Sozialismus“ keinesfalls die versprochene glorreiche Zukunft bringen würde.
Zu dieser Erkenntnis hatten mir die ersten verbotenen Bücher verholfen, die ich ab dem Herbst 1960 in die Hände bekam 3), ein Besuch in Westdeutschland im März 1961, bei dem ich dort nirgends den in der Schule verkündeten „sterbenden Kapitalismus“ entdeckt hatte, und die Gespräche mit den Arbeitern im Betrieb, von denen einige ältere mein Denken in Richtung einer demokratischen Variante von Sozialismus bzw. eines „Dritten Weges“ zu lenken verstanden. 4)
Die sechziger Jahre in der DDR waren ein auffällig widerspruchsvolles Jahrzehnt. Auf der einen Seite war die politische Führung ausgesprochen reformfreudig, stellte sie immer wieder selber Strukturen der eigenen Gesellschaft in Frage 5), auf der anderen Seite aber herrschte sie immer noch höchst autoritär, teilweise sogar brutal. Ein neu aufgekommener Technokratismus und ein weiter bestehender Stalinismus hatten zu einem merkwürdigen Amalgam gefunden.
Читать дальше