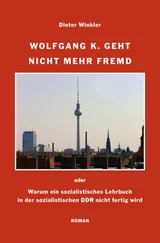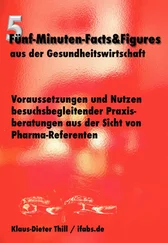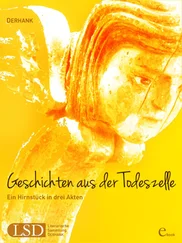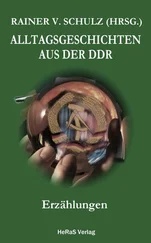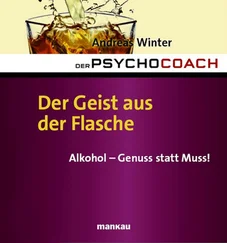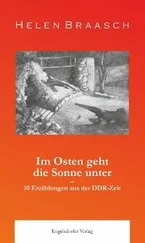In meiner Studentenzeit 1962 bis 1967, immer noch in Leipzig, gehörte ich zu den Kommilitonen, die hin und wieder als „Abweichler“ auffielen. Neben Freunden oder mir selbst in die DDR mitgebrachter Literatur wie Jaspers „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte“, Klaus Mehnerts „Der Sowjetmensch“, Sartres „Marxismus und Existentialismus“, Djilas' „Gespräche mit Stalin“, dem Godesberger Programm der SPD, aber niemals einem Exemplar der in Westdeutschland verlegten Zeitschrift „Der 3. Weg“, las ich in der einzigen Leipziger Bibliothek, in der man in den Sechzigern so etwas ohne „Giftschein“ in die Hände bekam – der Bibliothek des Museums für Geschichte der Leipziger Arbeiterbewegung im Dimitroffmuseum, dem ehemaligen Reichsgericht – marxistische Autoren nichtleninistischer Provenienz wie Bernstein und Kautsky 6)sowie Rosa Luxemburgs damals noch verbotene Schrift „Die Russische Revolution. Eine kritische Würdigung“ 7). Bei Marx selber entdeckte ich später die mit der angeblich von Marx' Erkenntnissen geprägten politischen Realität in der DDR so überhaupt nicht korrelierende Aussage, dass die Freiheit das „Gattungswesen des ganzen geistigen Daseins“ sei. 8)In der gleichen Schrift ist übrigens der Satz zu finden: „Kein Mensch bekämpft die Freiheit; er bekämpft höchstens die Freiheit der anderen.“ 9)Auf ihn geht wahrscheinlich die berühmte Bemerkung von Rosa Luxemburg zurück, dass Freiheit „immer die Freiheit der Andersdenkenden“ ist. 10)
Natürlich suchte man in meinen Kreisen auch nach Widersprüchen bei den ansonsten überaus respektierten Marx und Engels. So glaubte ich, diesen Widerspruch entdeckt zu haben: Nach Marx soll der Mensch im Kommunismus nach seinen Fähigkeiten arbeiten und nach seinen Bedürfnissen erhalten. Gleichzeitig wusste Marx aber, dass jede Bedürfnisse befriedigende Produktion neue Bedürfnisse hervorbringt. Damit musste, so fand ich, die Befriedigung von Bedürfnissen neu ausbrechenden Bedürfnissen stets hinterherlaufen.
Vielleicht verfügte das Leipzig der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts über ein paar Voraussetzungen, den Traum von einem „Dritten Weg“ in besonderem Maße sprießen zu lassen.
Als erstes besaß Leipzig in der damaligen DDR den Ruf, besonders „dogmatisch“ zu sein 11), weil an der Spitze des Parteiapparates des Bezirkes ein Mann stand, der nur in sehr groben Rastern zu denken vermochte. Er war nach meiner Erinnerung in den meisten Gruppen der Leipziger Intelligenz höchst unbeliebt und provozierte durch Äußerungen und Maßnahmen immer wieder eine stille, aber unübersehbare Ablehnung des durch ihn repräsentierten Typs von Gesellschaft.
Als zweites hatten an der Leipziger Universität nach dem Ende der NS-Herrschaft einige bedeutende liberal-kommunistische Wissenschaftler wie Ernst Bloch, Hans Mayer oder Werner Krauss Lehrstühle erhalten, so dass in größeren Teilen der damaligen intellektuellen Szene Leipzigs ein Wissen hochgradig existent war, dass Sozialismus auch anders als uns vorgeführt gehen müsse.
Als drittes wirkten in Leipzig geistige Einflüsse von außerhalb des abgemauerten Staates intensiver als in der übrigen DDR. Die hohe Zahl ausländischer Studenten – im Studentenklub stieß ich sogar auf einen Kommilitonen aus dem fernen Neuseeland –, zu denen man den Kontakt suchen konnte und aus deren Erzählungen man gesellschaftliche Realitäten und gesellschaftliche Vorstellungen von anderswo in der Welt zu rezipieren vermochte bzw. von denen man gelegentlich sogar verbotene Literatur mitgebracht bekam 12), war ein erstes Element von größerer Weltoffenheit. Das zweite war, last not least, die Leipziger Messe, in deren Buchhaus sich nicht wenige Studenten immer wieder auf nicht legale Art und Weise mit westlicher Literatur versorgten. 13)
Da zum Zwecke der Diskussion eines „Dritten Weges“ gegründete Gesprächskreise in den sechziger Jahren von der Staatsmacht umgehend unterdrückt worden wären, Überlegungen in diese Richtung aber ziemlich verbreitet waren, existierten auf der einen Seite nur rein informelle Formen von Gedankenaustausch zum Thema 14), und waren auf der anderen Seite die Ergebnisse von Überlegungen und Gedankenaustausch sehr an die intellektuellen Fähigkeiten und Interessen von Individuen gebunden. Kritik richtete sich in meinem Bekanntenkreis nahezu nie gegen das „sozialistische Ideal“, aber mehr oder minder radikal gegen die von uns erfahrene „sozialistische Realität“. Allerdings hatten auch wir Illusionen. Etwa die, dass z. B. ich damals glaubte, der Einzug von Demokratie in die Gesellschaft würde auch – eindimensional – den Einzug von mehr Vernunft in die Gesellschaft nach sich ziehen. Unsere Ablehnung bezog ich aber niemals vorrangig auf Personen – man denke nur an die 1953 populäre Losung „Der Spitzbart muss weg“ –, sie galt stets politischen und sozialen Strukturen.
Hatte auf dem Gebiet der Politik der damalige sowjetische Parteiführer, der „Entstalinisierer“ Chruschtschow, schon selbst auf das Beispiel USA verwiesen, als er die Begrenzung der Verweildauer von seinesgleichen an der Spitze von Partei und Staat auf zwei Legislaturperioden begrenzen wollte 15), so gingen Nicht-Parteimitglieder wie ich natürlich über diesen Vorschlag hinaus: Der erste Mann im Staat sollte unserer Meinung nach nicht mehr von einer Parteiführung aus sich heraus bestimmt, sondern vom Volk gewählt werden. Wiederum wie in den USA sollten zwei Kandidaten zur Wahl stehen, die für eine unterschiedliche Handhabung des vorhandenen Gesellschaftssystems – in unserem Falle also eines sozialistischen – stehen sollten.
Dazu wollten meine Gleiches, Ähnliches oder Anderes denkenden Freunde und ich natürlich durchgängig echte Volksvertretungen, die nicht einfach die vom SED-Apparat und seiner Nationalen Front vorgefertigten Gesetze und Beschlüsse diskussionsarm abnickten; wir wollten Volksvertretungen aus geheim gewählten Persönlichkeiten, die von – sich zu Demokratie, Solidarität und Antifaschismus bekennenden – Parteien und Massenorganisationen, auch neu gegründeten, zur Wahl gestellt werden sollten. Auf den prinzipiell öffentlichen Tagungen dieser Volksvertretungen sollten auch Delegierte betroffener Bürger, Vereine und Interessengruppen Anhörungs- bzw. Rederecht erhalten. Spenden von Interessenorganisationen an Parteien und Massenorganisationen sowie ein professionell betriebener Lobbyismus kamen in den Vorstellungen von meinesgleichen von moderner Demokratie nicht vor. Unsere Demokratie sollte zweifellos „bürgerlicher“, aber nicht „kapitalistischer“ werden. Die Idee von Volksabstimmungen wie in der Schweiz fanden wir, ohne Genaueres über deren Handhabung zu wissen, ausgesprochen anziehend.
Obwohl meine Freunde und ich den Großteil unserer politischen Informationen aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern Westdeutschlands bezogen (sowie vom Rias und dem deutschsprachigen Dienst der BBC), bestand bei einem Teil von uns – infolge der in ihr stattgefundenen gesellschaftlichen Restauration, vor allem der Übernahme so vieler ehemaliger Nazis in leitende Stellungen jeglicher Couleur – gegenüber der 1949 in Westdeutschland neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland erst einmal ein unübersehbar reserviertes Verhältnis. Erst mit dem Auftreten der „68er“ sollte sich das ändern.
Parallel zu dem Nachdenken über demokratischere politische Strukturen verlief ein Nachdenken über wirtschaftliche Reformen. Reformen in der Wirtschaft hielten in den Sechzigern bekanntlich auch Parteiführungen für nötig, die an politische Reformen weniger zu denken wagten. 16)Im Mittelpunkt der Überlegungen der Wirtschaftsreformer der kommunistischen Parteien – in der DDR vor allem Apel, in der ČSSR Šik und in Ungarn Nyers – standen Änderungen hin zu einem anderen Typ von Reproduktion, Reformen bei den Relationen zwischen Planung und Markt, anders strukturierten Eigentumsverhältnissen bei den Produktionsmitteln bzw. einen effizienteren Umgang mit dem juristisch staatlichen Eigentum an diesen Produktionsmitteln.
Читать дальше