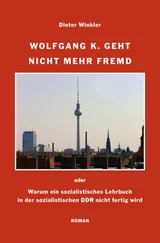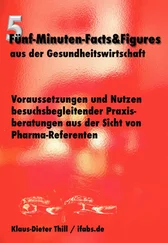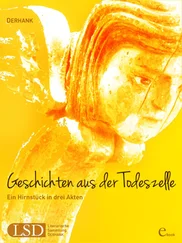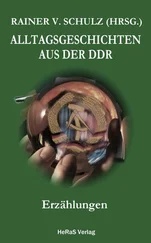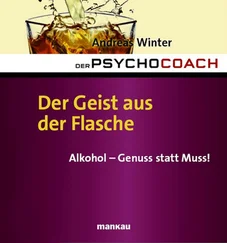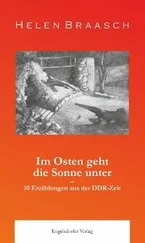19) Zu den unsinnigsten Dogmen, die DDR-Studenten Anfang der 60er Jahre noch erlernen mussten, hatte gehört, dass im „Sozialismus“ alle Produktion „unmittelbar gesellschaftlich“ sei, ihre Erzeugnisse sich also nicht erst auf einem Markt zu bewähren hätten. Die bekannte Folge: Lagerbestände bei unverkäuflichen Waren bei gleichzeitigem Mangel an von der Bevölkerung gewünschten. Marxistisch denkenden Ökonomen war in den 60ern – manchen nur vorübergehend – klar geworden, dass in einer modernen, hochgradig arbeitsteilig produzierenden Wirtschaft der Austausch nur über einen intelligent regulierten Markt erfolgen kann. Reguliert bedeutete für meinesgleichen damals allerdings immer: Reguliert nicht durch eine Bürokratie, sondern durch Gesetz und Justiz.
20) Wie das Beispiel der heutigen staatlichen Landesbanken zeigt, wäre so etwas nicht nur für Unternehmen in „sozialistischem Eigentum“ angebracht gewesen.
21) Im Kulturbereich war ich z.B. darauf gestoßen, dass Freiberufler nur zwei Steuerklassen kannten: einen Regelsatz von 20% auf ihre Honorare und einen Ausnahmesatz von 10% bei sehr niedrigem Einkommen.
22) Wie zugleich „sozialistisch“ und „freiheitlich“ meinesgleichen damals dachte, zeigt z. B. mein Studentenstück von 1968 „Die Fragen und die Freiheit“. In: Torsten Hilse/Dieter Winkler (Hg.): Die Fragen und die Freiheit. Schubladentexte aus der DDR. Berlin 1999
23) 1969 hatte ich auf einem westdeutschen Rundfunksender von einem ehemaligen Mitarbeiter Ota Šiks in fehlerfreiem Deutsch hören können, dass die Sowjetunion und ihre Führung in einigen Jahren vor der gleichen Notwendigkeit von Reformen stehen würden wie die ČSSR 1967/68
24) Allerdings war Ende der 60er Jahre noch keinesfalls zu vermuten, dass der Bruch vieler Nomenklaturakinder mit dem „Realsozialismus“ und dem Gewäsch ihrer Eltern vom „neuen sozialistischen Menschen“ ein Vierteljahrhundert später so weit gehen würde, dass sie statt eines Reformsozialismus in „ihren“ Ländern einen brutalen Kapitalismus einführen und dabei vor allem die ehemaligen Staatsbetriebe mit Tricksereien ganz rasch in ihre höchst privaten Hände überführen würden.
25) Ich habe bis heute die Phantastereien zweier junger Ostberliner in einer S-Bahn nach Pankow Anfang März 1990 nicht vergessen, mit denen sie sich für die ihrer Meinung nach zu erwartenden Folgen einer Wahl Helmut Kohls am 18. März jenes Jahres begeisterten: Wie hoch ihre Nettoeinkommen bei westdeutschem Arbeitslosengeld und ostdeutschen Mieten künftig sein würden und welchen schweren Westwagen sie sich davon wann würden leisten können. „Wahnsinn“ nannten sie, was tatsächlich Wahnvorstellungen waren.
26) Die westdeutsche Marktwirtschaft machte nach dem „Beitritt“ eine weitere gewichtige Wandlung durch: Die Politik sah ihre Aufgabe nicht mehr vorrangig darin, gleiche Rahmenbedingungen für miteinander im Wettbewerb stehende Unternehmen zu setzen, sie veränderte diese Rahmenbedingungen dahingehend, dass sie selbst Marktteilnehmer wurde. Die Politik trat in einen Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen bzw. um ein Wohlgefallen von „Investoren“. Und denen musste sie dann folgerichtig gute und bessere „Standortbedingungen“ bieten, also niedrigere Steuern und Löhne. In der Folge dieses „Umbaus“ der sozialen Marktwirtschaft konnte die nur Aspekte ihres sozialen Charakters verlieren.
27) Zu den Ironien der Geschichte gehört, dass demokratisch-sozialistische Intellektuelle, in denen vordem vor allem und zu Recht „Demokraten“ gesehen worden waren, nach 1990 gern wieder als „Sozialisten“ abgelegt wurden.
In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war ich
Arbeiter (vom September 1960 bis zum August 1962)
Student (vom September 1962 bis zum Juli 1967)
Absolvent (ab September 1967)
Als im Herbst 1960 im VEB Drehmaschinenwerk Leipzig mein bisheriges Wissen und Denken und die Realität der „sozialistischen Praxis“ verschärft aneinander gerieten, glaubte ich – wie andere Menschen vor mir und nach mir auch – mich mit dieser Situation in einem Tagebuch auseinandersetzen zu sollen. Wegen beträchtlicher Konflikte mit meinen SED-Kommilitonen im 1. Studienjahr Geschichte/Marxismus-Leninismus führte ich das Tagebuch danach weiter: das ganze Jahrzehnt hindurch.
Die Notizen aus den ersten Studienjahren sind bei einem westdeutschen Freund verloren gegangen, dem ich sie für die „Zeit danach“ zur Aufbewahrung mitgegeben hatte. Andere Teile des Tagebuchs, selbst durch mich heute kaum mehr entzifferbar, habe ich nach dem Tod meiner Mutter 1991 in deren Möbeln wiedergefunden. Bei ihr in Merseburg und später Halle hatte ich sie vor einer möglichen Hausdurchsuchung bei mir in Leipzig und danach Berlin verbergen wollen. Einige weitere Texte hatte nach meinem Umzug nach Berlin eine Bekannte in Leipzig auf ihrem Boden versteckt.
Wie die bereits in den „Schubladentexten aus der DDR“ von mir abgedruckten Texte stammen auch diese hier von einem höchst unwichtigen ehemaligen Bürger der DDR. Sie weisen gerade damit, glaube ich, nicht nur auf Stimmungen und Meinungen bei mir, sondern auch in dem Milieu, dem ich damals angehörte.
1960
Schulfest in der ehemaligen EOS. B. zu mir: „Das Pendel schlägt bei dir etwas aus. Aber es wird dich auch wieder auf die Linie bringen.“
(EOS = Erweiterte Oberschule)
So wie Ludwig XIV. einst: Der Staat bin ich, heute Walter Ulbricht: Die Arbeiterklasse bin ich.
1961
Ein Stück Stange aus dem Betrieb mitgenommen. Über das, was aus der Tasche herausguckte, habe ich einen Strumpf drübergesteckt. Der Betriebsschutz sagte nichts.
Spruch für einen Funktionär: „Ich schwöre und gelobe … das richtige Parteibuch in der Tasche zu haben.“
Disput mit einem Philosophiestudenten. Er war der Meinung, in 50 Jahren ist mit dem Kapitalismus Schluss.
Hatte Nachtschicht. Polsterte meine Eidechse aus und las zwei Stunden in der Härterei.
(Eidechse = Elektrokarren, Härterei = Abteilung im Betrieb)
War zu den Philosophiestudenten, die ein Praktikum im Betrieb absolvierten, eingeladen. Einer hatte einen Arbeiter zu seiner Meinung nach der Ermordung Lumumbas befragt. Der Arbeiter: Ich bin gegen den Mord. Aber was hat man in der Sowjetunion zwischen 1936 und 1938 gemacht!
Einer der Studenten: Früher im Kapitalismus ging es den Arbeitern so, heute im Sozialismus so. Also besser! –
Er vergaß, dass der Kapitalismus eine Entwicklung durchgemacht hat: Dass es dem westdeutschen Arbeiter besser geht als dem ostdeutschen.
(Lumumba = Erster Ministerpräsident von ehemalig Belgisch-Kongo nach der Kolonialzeit)
Kadergespräch. Zeigte mich als Beherrscher der politischen Phrase. Gab zum Moskauer Manifest der Kommunistischen und Arbeiterparteien eine – akzeptierte – Meinungsäußerung, ohne dieses Manifest gelesen zu haben. Danach auf der Polizei Anträge für die Westdeutschlandreise von mir und meiner Großmutter geholt.
Gespräch mit dem Kaderleiter zur Westreise. Er warnte mich vor Gefahren im Westen. Nachmittags zu einem Vortrag über Krieg und Frieden delegiert (in der DHFK), verdrückte mich schon kurz bevor der Vortrag begann.
(DHFK = Deutsche Hochschule für Körperkultur)
Diskussion bei einem Kulturangestellten der Stadt. Der: In dem Schlager „Einmal nur die Heimat sehen“ würde sich Revanchismus zeigen.
Читать дальше