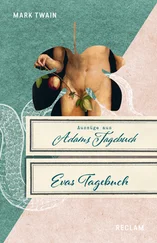„Du bleibst, wo du bist, Michael!“, sagte sie streng. „Du rührst dich nicht und gibst keinen Laut von dir. Hast du das verstanden?“
„ Maman , bitte, bitte! Ich mache mich auch ganz klein. Dann kannst du dich mit mir hier unten verstecken. Bitte, Maman !“, flehte ich sie an und wand mich in ihren Händen.
„ Non, chéri !“, rief sie und schüttelte mich heftig. Ihre Härte machte mich sprachlos. Noch nie zuvor hatte sie mich so behandelt. Alles, was ich tun konnte, war zu nicken. „Du bist mein kleiner braver Michael“, sagte sie etwas sanfter und zwang sich zu einem Lächeln. Ich versuchte es zu erwidern. Es fiel mir schwer, und es fühlte sich falsch an. „Ich liebe dich, chéri . Du bist mein Stern. Für immer“, flüsterte sie und strich mir ein letztes Mal zärtlich über die Wange. Dann ließ sie mich los und begann, die Bretter wieder an ihren ursprünglichen Platz zu legen. Erst als nur noch ein Brett fehlte, fand ich meine Stimme wieder und sagte leise: „Ich liebe dich, Maman .“ Ich hoffte, sie hatte es gehört.
Es drang nur wenig Licht durch die schmalen Ritzen zwischen den Brettern zu mir hinunter. Ein lautes Schaben von Holz über Holz erklang. Schatten zogen über mir vorüber. Ich glaube, meine Mutter hatte den Tisch wieder über das Versteck gestellt. Als das Rumpeln aufgehört hatte, hörte ich ihre Stimme sagen: „Du musst leise sein, Michael. Was auch immer geschieht, du darfst auf gar keinen Fall einen Ton von dir geben. Wenn sie dich finden, chéri …“ Sie ließ das Ende des Satzes offen. Sie war eine kluge Frau; sie ahnte wohl, was geschehen würde. Ich tat es nicht. Ich war ein Kind, das nichts von der Welt wusste und welche Schrecken in ihr wüteten. Ich wusste nichts von Raub und Mord. Für mich war es nicht vorstellbar, was ein Mensch einem anderen antun konnte. Ich hatte schon Hässliches mit ansehen müssen, wie zum Beispiel die Schlachtung eines Huhns, als ich sechs Jahre alt war. Meine Mutter hatte nicht gewollt, dass ich es in dem Alter schon sah, aber mein Vater hatte darauf bestanden. „Irgendwann muss er es lernen“, hatte er gemeint. Ich hatte wochenlang Alpträume von einem kopflosen Huhn, das noch atmend und lebend über unseren Hof rannte. Doch das mit Abstand Grausamste, was ich je erlebt hatte, war der Gnadenschuss, den mein Vater vor einem Jahr einem Fohlen gab, das sich das Bein gebrochen hatte. Ich war der Meinung gewesen, dass es bestimmt heilen würde und versuchte, meinen Vater umzustimmen, versprach ihm, ich würde mich selbst um das Jungtier kümmern, bei ihm im Freien schlafen und es pflegen. Ich stieß damit bei ihm auf taube Ohren. Meine Mutter hatte mir damals erklärt, wieso er es tun musste. Aber auch wenn es uns mit einem schlecht zusammengewachsenen Bein nicht mehr hätte dienen können, hätte ich wenigstens noch einen Spielkameraden und Freund gehabt. Ich hatte keine Freunde, mit denen ich toben konnte. Das Einzige, was Freunden am nächsten kam, waren die Tiere auf unserem Hof. Andere Kinder sah ich nur ein- bis zweimal im Jahr, wenn mein Vater meine Mutter und mich an unseren Geburtstagen mit auf den Markt nahm, zur Feier des Tages sozusagen. Dann durften wir uns eine Kleinigkeit aussuchen: ein Stück Geschirr, eine seltene Süßigkeit oder ein Spielzeug. Natürlich waren diese Ausflüge etwas Großartiges und Aufregendes. Mir gingen jedes Mal die Augen über vor Staunen über die Menge an Menschen und Waren, die es dort gab. Viel interessanter war es, andere Kinder zu sehen, Jungen und Mädchen, die so alt waren wie ich. Oft genug hatte ich auf unserem Hof in unserer kleinen Welt das Gefühl, ich sei das einzige Kind auf der Welt. Aber wenn ich dann die anderen Kinder sah, wusste ich, dass ich nicht allein war. Trotzdem waren sie nicht die ganze Zeit bei mir; ich konnte keine richtige Beziehung zu ihnen aufbauen, nicht einfach zu ihnen hinüberlaufen, sie nicht besuchen und meine Geheimnisse mit ihnen teilen. Meine Mutter hatte über mein Argument nur gelächelt und mir versichert, dass ich noch viele tierische Spielkameraden finden würde. Das tat ich auch, aber an keinen von ihnen erinnere ich mich so gut wie an das Fohlen. In dem Loch hockend, überlegte ich, ob das, was uns bevorstand, damit vergleichbar war, was ihm passiert war. Je länger ich darüber nachdachte, desto unheimlicher wurde es mir. „ Maman , ich fürchte mich“, sagte ich. Eine Weile blieb es still, und ich dachte schon, sie hatte mich nicht gehört. Doch dann sprach sie: „Ich auch, mein Liebling. Ich fürchte mich auch.“ Wieder Stille. Dann ihre Schritte, die im Haus umhergingen. „Sie kommen immer näher und näher.“ Ihre Stimme zitterte. Ihre Schritte entfernten sich von mir. Ich konnte nur erahnen, wo im Haus sie sich befand: im Schlafbereich, an der Haustür, bei der Kochstelle. Es rumpelte und polterte. Meine Mutter fluchte; sie rannte hin und her. Sie suchte nach etwas. Schließlich gab sie einen kleinen Freudenschrei von sich und sagte: „ Oui , es ist besser als nichts.“ Was auch immer sie damit meinte. Ich hörte, wie sie durchs Zimmer lief. Ich vermutete, dass sie zum Fenster ging, durch das man unseren Hof und die Felder davor gut überblicken konnte. „ Mon Dieu !“, hauchte sie. „Bete für uns, Michael. Bete für ein Wunder.“
Ohrenbetäubender Lärm kam auf. Stimmen ertönten. Schwere Schritte polterten über die Fußbodenbretter. Die Fremden waren im Haus.
Es war ein wildes Durcheinander, das über mir herrschte. Meine Mutter schrie. Ich hörte dumpfe Geräusche und weiteres Rufen. Dieses Mal jedoch war es eine männliche Stimme, die sich vor Schmerz erhob. „ Merde ! Sie hat mich gebissen.“ Vor Stolz darüber, dass sie sich wehrte, wollte ich in Jubel ausbrechen, riss mich aber zusammen und dachte lächelnd: Gut gemacht, Maman! Doch die Strafe für ihre Tat folgte umgehend. Ein Klatschen ertönte, das mich sofort an die Ohrfeigen erinnerte, die mir mein Vater verpasst hatte. Dieses Geräusch und auch das Gefühl vergisst man nie. Meine Mutter schrie, dann rumpelte es laut. Die Bodenbretter vibrierten und Sand und Staub rieselten zu mir herunter. Man hatte sie offenbar so hart geschlagen, dass sie von der Kraft der Hand, die sie getroffen hatte, von den Füßen gerissen worden war. Ihr Aufprall verursachte einen solchen Krach, ich glaubte, die Bretter würden jeden Moment bersten und mein Versteck preisgeben. Um nicht laut nach ihr zu rufen und sie zu fragen, ob es ihr gut ging, musste ich mir die Hand auf den Mund pressen. Das höhnische Lachen der Fremden drang an meine Ohren.
„Seht sie euch an! Kraucht auf allen vieren über den Boden und glaubt immer noch daran, sie könne uns entkommen“, grölte einer von ihnen. Es war eine andere Stimme, die ich zuvor noch nicht gehört hatte. Aber durch wie viele Männer wurde meine Mutter bedroht? Ob es auch Frauen unter den Unholden gab?
Eine neue, eine dritte Stimme sprach. „Vielleicht hat sie es auch gern, unten zu sein? Wenn ihr versteht, was ich meine.“
Damals verstand ich es nicht. Heute weiß ich, was seine Worte zu bedeuten hatten, und sie widern mich an! Den Schurken hingegen gefielen sie. Sie schienen dadurch sogar angespornt zu werden, in ihrem Tun fortzufahren. Ihr Lachen wurde lauter; sie gaben seltsame Laute von sich, grunzten und stöhnten. Irgendwann wurde es ihnen jedoch langweilig. Der Mann, dessen Stimme ich zuerst gehört hatte, rief: „Genug! Ich habe dieses Spiel satt. Lasst uns endlich zur Sache kommen!“
Schritte, von denen ich vermutete, dass sie zu ihm gehörten, polterten über mich hinweg. Meine Mutter schrie laut auf. Ich hörte das unverkennbare Geräusch von Schlägen in ein Gesicht. Der Krach schwoll an. Ich glaube, meine Mutter und dieser Widerling rauften heftig miteinander. Seine Freunde jubelten und feuerten ihn an, während ich in meinem Loch hockte. Hilflos und mit Tränen überströmtem Gesicht starrte ich hinauf zu den Brettern, die mich von der Szene oben trennten. Als ich meine Mutter kämpfen hörte und erkannte, wie tapfer sie sich wehrte, begann ich über mein Versprechen nachzudenken. Meine Mutter hatte mir beigebracht, dass man seine Versprechen einhalten muss. Wenn man es nicht tut, wäre man unzuverlässig und ein Lügner dazu. Ich wollte weder das eine noch das andere sein. Aber ist es richtig, an einem Versprechen festzuhalten, wenn jemand, den man liebt, in Gefahr ist? Ist es dann noch wichtig, ob man dadurch zum Lügner wird? Ist man nicht auch zuverlässig, wenn man auf denjenigen Acht gibt, der einen die Welt bedeutet? Und was war mit der Rede meines Vaters vor seiner Abreise? Hatte er mir nicht gesagt, ich sei nun der Mann im Haus?
Читать дальше