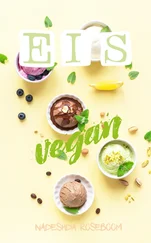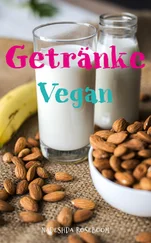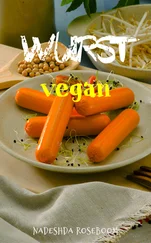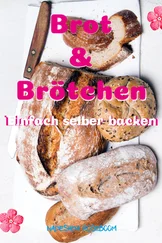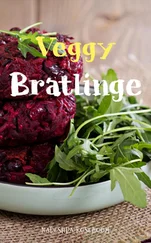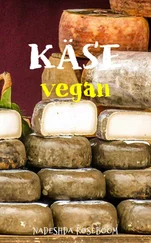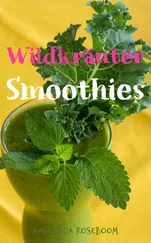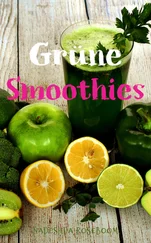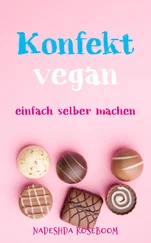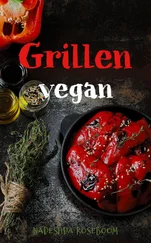Wildkräuter finden sich auf Wiesen und Äckern, an Wegrändern oder Waldrändern. Eigentlich fast überall, wo es grünt und blüht. Wenn man genau hinsieht, wird man sie selbst im eigenen Garten entdecken. Giersch, Gänseblümchen, Brennnesseln, Löwenzahn oder Wegerich gelten dort als Unkräuter, sie wuchern und verbreiten sich schnell, so dass man immer eine reiche Ernte hat.
Die meisten heimischen Pflanzen kann man bedenkenlos essen. Es gibt hierzulande nur vergleichsweise wenige giftige Pflanzen, wie den Schierling oder den Blauen Eisenhut. Diese Giftpflanzen sollte man kennen und sich ihr Aussehen gut einprägen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Einige Pflanzen sind roh ungenießbar, wie etwa Holunderbeeren oder Vogelbeeren. Diese müssen zunächst gekocht werden, um die giftigen Pflanzenbestandteile zu zerstören. Danach kann man sie bedenkenlos genießen.
Grundsätzlich gilt: Wenn Sie sich unsicher sind, lieber die Finger davon lassen. Sie können eine Probe mitnehmen und die Pflanze zu Hause mit einem Bestimmungsbuch oder über eine Botanik-Seite im Internet bestimmen. Es gibt inzwischen auch spezielle Apps zur Pflanzenbestimmung.
Beim Sammeln der Früchte müssen Sie auf die Jahreszeit achten. Dazu sollten Sie einen Jahreszeitenkalender verwenden. Wildpflanzen sind während der gesamten Wachstumsperiode verfügbar. Schon mit den ersten Frühblühern lohnt es sich, hinauszugehen und junge Triebe zu ernten. Die österliche Gründonnerstagsuppe wird traditionell aus den neun Wildkräutern Bärlauch, Brennnessel, Giersch, Gundermann, Gänseblümchen, Löwenzahn, Sauerampfer, Schaumkraut und Spitzwegerich zubereitet.
Beim Sammeln sollte man auf die Bedingungen vor Ort achten. Ideal sind frisch gemähte Wiesen, da Wildkräuter immer wieder nachwachsen und sich dort schnell neue, junge Triebe bilden.
Ackerränder auf landwirtschaftlichen Flächen sollte man meiden, obwohl Wildpflanzen dort aufgrund der der guten Nährstoffversorgung häufig sehr reichhaltig wachsen. Wenn jedoch kürzlich gedüngt wurde und Pflanzenschutzmittel verteilt wurden, da nimmt man mehr Jauche und Chemikalien als gesunde Inhaltsstoffe zu sich. In unserer Kulturlandschaft kommen leider immer mehr Pestizide und Herbizide zum Einsatz, die sich auch auf den umliegenden Flächen verteilen. Würzig duftende Kamille aus dem Rapsfeld sollte man daher besser stehen lassen, wenn man auf einen Chemiecocktail im Tee verzichten möchten. Auch Pflanzen direkt neben stark befahrenen Straßen oder an Bahndämmen sind nicht zu empfehlen.
Die beste Zeit zum Sammeln von Wildkräutern ist der frühe Morgen oder der Abend. Geerntet wird nach Möglichkeit bei trockenem, sonnigem Wetter. Mittagshitze oder feuchtes Wetter sind nicht ideal, da die Pflanzen dann schneller welken.
Gesammelt werden Triebe und Blätter, die sich leicht pflücken oder abbrechen lassen. Sie sind frisch und knackig und lassen sich daher gut verarbeiten und verdauen. Auch Blüten werden gern gesammelt. Achten Sie auf die Besonderheiten der jeweiligen Pflanze. Normalerweise sind alle Pflanzenteile essbar, vom Stängeln bis zu den Blüten, inklusive Blätter. Häufig gibt es jedoch geschmackliche Unterschiede. Daher sollte man bereits beim Sammeln darauf achten, nur solche Pflanzenteile mitzunehmen, die man später auch verarbeiten wild. Grundsätzlich gilt, maßvoll und nachhaltig zu sammeln. Nehmen Sie nur so viel, wie Sie verbrauchen. Schonen Sie die Natur. Reißen Sie keine ganzen Pflanzen aus, lassen Sie, wenn möglich, Wurzeln und Rhizome stehen, damit die Pflanzen nachwachsen können.
Die Pflanzen sollten in einem luftdurchlässigen Behälter transportiert werden. Es bieten sich Papiertüten oder kleine Pappschachteln an. Zu Hause sollten Sie die Pflanzen zunächst in den Kühlschrank legen, wenn Sie sie nicht sofort verarbeiten. Auch feuchter Stoff bietet sich an, um die Pflanzen länger frisch zu halten.
Wildkräuter sollten schnell verarbeitet werden. Andere Möglichkeiten sind Trocknen oder Haltbarmachen, zum Beispiel durch Einlegen in Essig oder Öl.
Die wichtigsten Wildkräuter auf einen Blick

Aussehen
Zwiebelpflanze mit je zwei breiten, lanzettlichen Blättern, deutlich parallel geadert, die aus der länglichen Zwiebel herauswachsen sowie bis 25 cm hoher Stängel, dreikantig mit sternenförmigen, weißen Blüten in einem halbkugeligen Blütenstand, typischer knoblauchartiger Geruch. In feuchten Auenwäldern bedeckt Bärlauch im Frühjahr als grüner Teppich den Waldoden und verbreitet den typischen, etwas knoblauchartigen Duft.
Standorte
Feuchte, humusreiche Laubwälder, Auenwälder, Buchenwälder, Gebirgswälder, bevorzugt schattig und humusreicher Boden.
Ernte
Gesammelt werden die Blätter von März bis Juni, je nach Standort, essbar sind jedoch auch Blüte (Mai bis Juni) und Wurzel.
Verarbeitung & Verwendung
Blätter ausgebreitet im Schatten unter häufigem Wenden trocknen oder frisch verarbeiten in Salaten, Soßen, Suppen, Quark, Kräuterbutter, Öl oder Pesto. Blätter nicht hacken, nur schneiden, da sie sonst bitter werden. Frische Blätter haben ein kräftigeres Aroma als getrocknete oder erhitzte. Die Zwiebeln in Olivenöl eingelegt ergeben ein aromatisches Würzöl.
Inhaltsstoffe
Vitamin C, Lauchöl, ätherische Öle, Fructosane, Flavonoide, Fermente, Uteruswirkstoff.
Sonstiges
Bärlauch wird auch als Heilpflanze verwendet, etwa bei Durchfall, Darmkatarrhen, Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwerden. Außerdem wirkt er Blutdruck senkend und schützt das Herz.
Verwechslungsgefahr der Blätter besteht mit denen des giftigen Maiglöckchens, das jedoch nicht nach Knoblauch riecht und eine glänzende Blattunterseite hat. Weitere Verwechslung mit Aronstab und Herbstzeitlosen möglich. Keine dieser Pflanzen hat den typischen Knoblauchgeruch des Bärlauchs und wächst flächendeckend.

Aussehen
Schlanker Baum, der eine Höhe von 25 Metern erreicht und eine weißliche Rinde hat, die sich stellenweise abschält. Herabhängende Zweige mit langstieligen, rhombisch-viereckigen zugespitzten Blättern. Männliche Kätzchen bräunlich und länglich-walzenförmig, die weiblichen grün, aufrecht und langgestielt.
Standorte
Lichte Wälder, Heidewiesen, Wegränder, sandiger und torfiger Boden.
Ernte
Nur die jungen Blätter von Mai bis Juni.
Verarbeitung & Verwendung
Birkenblätter haben einen milden, leicht herzhaften Geschmack. Sie schmecken in Salaten, Quark und Frischkäse, zu Gemüse oder als Beigabe in Kräutermischungen.
Inhaltsstoffe
Ätherische Öle, kleinere Mengen Saponine, Gerbstoffe, Vitamin C und Flavonglykoside
Sonstiges
Wird auch als Heilpflanze verwendet, insbesondere als harntreibendes Mittel in Form von Tee. Birkenblättern haben eine reinigende und Stoffwechsel anregende Wirkung und werden gern zu Frühjahrskuren gegen Frühjahrsmüdigkeit eingesetzt.
Brennessel
(Urtica dioica & Urtica urens)

Aussehen
Ein bis anderthalb Meter hohes Kraut mit unverzweigtem, vierkantigem Stängel und gegenständigen, vier bis fünf Zentimeter langen Blättern, eiförmig mit herzförmigem Grund lang zugespitzt und grob gesägtem Rand. Sowohl Stängel als auch Blätter sind mit Borstenhaaren und Brennhaaren besetzt, die bei Berührung leichte Brennungen und Hautrötungen (Quaddeln) verursachen.
Читать дальше