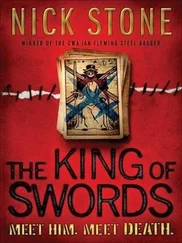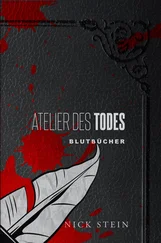Blöd, dass sie ihre Assistentinnen die ganze Arbeit machen ließ. Sie hatte keine Ahnung, was in dem Roman gestanden hatte.
Was wollte der eigentlich von ihr? Sich rächen, weil sie ihn beleidigt hatte, weil sie ihn verächtlich behandelt hatte, so was in der Art. So ein selbstherrlicher, beleidigter Typ, der Wunder was von seinem Geschreibsel hielt, wobei es unter Garantie wieder derselbe Mist war, den sie täglich hundertfach auf den Tisch bekam.
Ich will doch nur, dass mein Werk mit Respekt und Würde behandelt wird; diese Worte von ihm hallten immer noch in ihrem Kopf nach.
Aber das sagte doch jeder von ihnen, all die achthundert zukünftigen Literaturnobelpreisträger, die sich monatlich bei ihr meldeten und ihr Geschreibsel unbedingt gedruckt sehen wollten. Eine stinkende Flut, bei der es nur half, so rasch wie möglich die Spülung zu ziehen und den Mist loszuwerden.
Aber dieser Psycho hatte ihr das krummgenommen. Und jetzt lag sie hier unten und kam und kam nicht drauf, wie sie hier wieder rauskommen sollte. Es musste irgendwie gehen. Was, wenn das wirklich ein Test oder Teil einer Show war? Dann würde sie sich scheußlich blamieren. Wenn der jetzt was von ihr wollte, womöglich vor laufenden Kameras? In ihr sträubte sich alles bei dem Gedanken. Aber sie sah nichts von technischen Geräten in diesem stinkenden Verlies, so sehr sie den Kopf auch drehte.
Mona blähte ihre Nasenflügel und stieß hörbar ihren heißen Atem aus. Sie hatte keine Zeit für so einen Scheiß. Sie hatte zu tun, im Verlag und auch sonst, sie hatte gesellschaftliche Verpflichtungen, sie hatte diese Woche ein Date, und sie musste dringend aufs Klo.
»Hey! Ich brauche was zu trinken! Und ich muss zur Toilette!«, schrie sie ins Dunkle, in Richtung Treppe, über die der Typ verschwunden war.
* * *
So oder so ähnlich musste die Frau sich da unten jetzt wohl fühlen. Ich hatte zumindest schon mal einen Text. Aber jetzt musste ich sehen, wie es ihr wirklich ging. Und auch das musste ich dokumentieren. Denn Ihnen kann ich das beichten. Wenn Sie ein Leser und nicht auch ein Lektor oder eine Lektorin sind. Oder von der Polizei.
Ich hatte jetzt einen Plan. Den nächsten Lektor-Mord, ob fiktiv oder real, in meinen Krimi einbauen, den Roman an das nächste Lektorat senden, und vielleicht eine weitere Ablehnung erhalten; einen weiteren Lektor bestrafen und aus alldem eine Stafette aus Lektormorden aufbauen, solange bis das endlich jemand druckte, oder bis mich schließlich doch die Polizei erwischte? Oder bis der Republik die Lektoren ausgingen? War das ein guter Plan?
Ich war mir noch nicht sicher. Denn dann musste ich die Lektorin ja wirklich zum Verstummen bringen. Wollte ich das? Sicher, ich wollte sie bestrafen. Um viel mehr war es mir bis hierher nicht gegangen.
Musste ich jetzt weitermachen und sie töten, nachdem ich sie entführt hatte und hier gefangen hielt? Kaum vorstellbar, dass ich sie jetzt noch zu einer Zusammenarbeit überreden konnte. Aber vielleicht konnte ich sie zu mehr Einsicht bewegen; dann könnte ich ihr später, anonym natürlich, ein anderes Werk anbieten. Dann war sie womöglich einsichtiger geworden.
War es schon zu spät für eine Rehabilitation und eine Freilassung? Musste ich sie jetzt aus der Welt schaffen? Nicht, dass ich das nicht zu Ende bringen könnte, ganz im Gegenteil. Ich bin viele Jahre lang Soldat gewesen, und wer einmal Soldat war, bleibt es sein Leben lang. Töten ist leicht, und Skrupel habe ich noch nie gehabt.
Trotzdem. Ich habe ein gewisses Problem mit den Opfern. Sie hinterlassen Blut und Dreck, wenn sie sterben. Davon hatte ich in meinem Leben schon genug gesehen. Ich finde das widerlich. Das Blut spritzt und schmiert, es läuft überall hin, es klebt und riecht und hinterlässt Spuren. Darm und Blase entleeren sich unkontrolliert. Man muss das wegmachen, man kommt mit diesem Unrat in Kontakt. Macht sich schmutzig. Es stinkt zum Himmel. Und all die Drecksarbeit bleibt an einem selbst hängen. Keine afghanischen Helfer, die einem das klaglos wegräumen. Jemanden beseitigen, gut. Aber der ganze Dreck kann mir gestohlen bleiben.
Frau Meyer-Hinrichsen lebte ja noch.
Wie sollen Leser denn meine Werke in die Hände bekommen, wenn sich diese lustlosen und bequemen Lektorinnen nicht einmal bemühen, sie auch nur anzulesen?
Mona Meyer-Hinrichsen schrie unten im Keller herum. Jetzt brauchte sie mich. Dafür hatte ich schon mal gesorgt. Vorher hatte sie mich ja anscheinend überhaupt nicht gebraucht.
Es gab eine Zeit, da war es mir um spektakuläre und geniale Exzesse gegangen, um Bestrafungen, die ihresgleichen suchten, öffentliche Bloßstellungen, Hinrichtungen, ohne dafür belangt werden zu können. Perfekte, großartige Morde. Heute bin ich bescheidener geworden; das Spektakel brauche ich nicht mehr.
Mir geht es inzwischen mehr um chirurgische Präzision, wenn jemand verschwinden muss. Nicht, was Sie jetzt beim Wort chirurgisch denken; jemanden langsam und genüsslich mit dem Skalpell aufzuschlitzen. Sicher, manch einer mag das, und solche Leute habe ich in Afghanistan zur Genüge kennengelernt.
Wenn man den Opfern in die aufgerissenen Augen sieht, wie die armen Kerle versuchen zu begreifen und doch mitansehen müssen, wie das Leben aus ihnen herausspritzt. Die aufgerissenen Münder, die den Schmerz herausschreien, all das. Natürlich. Manch einer findet das sehr, sehr schön. Es hat auch was.
Mein Ideal ist das trotzdem nicht, im Gegenteil. Das geht auch eleganter, sauberer und klinischer. Und ohne Spuren zu hinterlassen. Leute ohne das ganze Geschmiere zu beseitigen, das ist eine reizvolle und lohnenswerte Aufgabe.
Mein Ideal ist die chirurgische, non-invasive Entfernung einer störenden Person aus dieser Welt. Sauber. Perfekt. Unauffällig. Elegant. Vielleicht verstehen Sie ja, was ich meine. Ein soziales Skalpell, mit dem man jemanden für immer verschwinden lassen kann. Ohne den ganzen Dreck. Ich bin kein Sadist. Ich bin nur entsetzlich enttäuscht. Und gewohnt, ordentlich zu arbeiten. Und ich wollte endlich ein Buch veröffentlichen. Mein Buch. Meine Geschichte.
Die Lektorin lag da wie das wunderschöne Opfer in dem Roman, der ihren Wünschen entsprach. Es war schön, wie sie ihr Wunschthema in die Realität übertrug, ohne es zu wissen. Wenn sie selbst auch längst nicht so schön war wie das literarische Opfer; sie war eher klein und mager, hatte aber ein ansprechendes Gesicht zwischen ihren kleinen Ohren und unter ihren kurzen, schwarzen Haaren.
»Ich habe Durst, und ich muss mal«, stöhnte sie leise. Immerhin nicht: Wo bin ich? Dann hätte ich sie womöglich gleich umgebracht. Ich hasse Klischees.
»Das ist bald vorbei«, sagte ich zu ihr.
Sie drehte langsam den Kopf. Sehen konnte sie mich nicht. Sie lag im Lichtkegel eines Deckenstrahlers, der Rest des Kellers lag im Dunkeln. Ich trug Schwarz, über dem Kopf eine leichte Skimaske, die mir hervorragend stand, dazu eine verspiegelte Brille. Das würde das Einzige sein, was sie je von mir zu sehen bekam. Ich sehe zu markant aus, als dass man mein Gesicht wieder vergessen könnte. Und solange sie mich nicht sehen konnte, hatte sie eine Chance, zu überleben.
»Wer sind Sie? Was mache ich hier?«, krächzte sie. Und dann leider doch: »Wo sind wir hier?« Sie versuchte sich aufzurichten, aber das scheiterte. Sie war mit Hand- und Fußschellen lose an das Gitterrost am Boden gekettet, die Ketten dazwischen ließen der am Boden gekreuzigten Lektorin ein wenig Spielraum. Aber nicht genug, um sich ganz aufzusetzen.
Okay, sie war durstig und musste auf die Toilette. Zumindest dafür hatte sie mein Mitgefühl. Ich ging rüber und lockerte mit dem Fuß vorsichtig eine der Bodenfliesen, auf denen sie lag. Darunter verborgen lag ein Schlüssel für ihre Handschellen. Hätte sie ihn entdeckt, hätte sie sich befreien können, so viel Spielraum ließ ihr die Fesselung. Aber nichts dergleichen hatte sie geschafft. Ein Zeichen mehr dafür, dass sie keine Ahnung und kein Gespür hatte. Ein guter Lektor hätte alles probiert und sich vielleicht befreien können.
Читать дальше