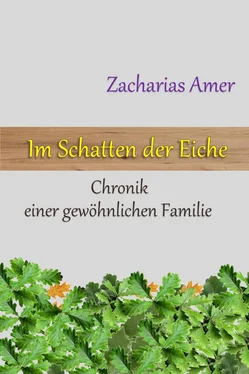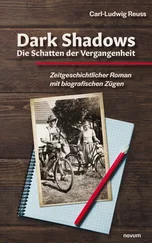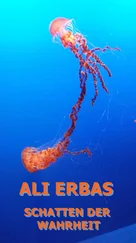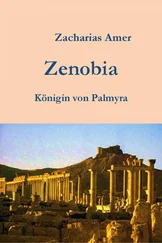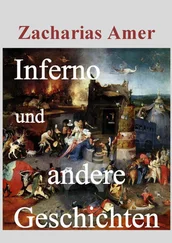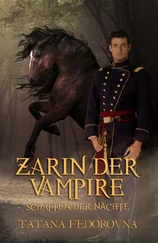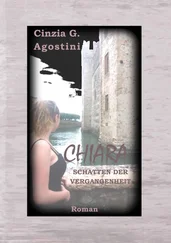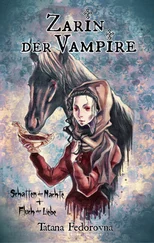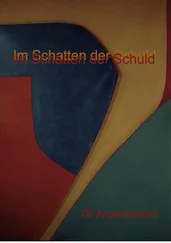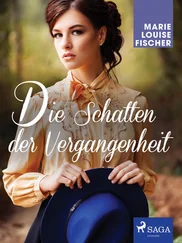Einerseits sind manche Wörter so lang, dass ein einziges Wort eine ganze Zeile für sich in Anspruch nimmt, andererseits reißen sie manche Wörter so weit auseinander, dass am Anfang der Seite die eine Hälfte des Wortes steht und am Ende die zweite. Bis man dahin kommt und das Getrennte gedanklich zusammenfügt, ist einem, wie bei Mark Twain, unterwegs längst die Luft ausgegangen und man hat das Interesse am Inhalt des Satzes längst aufgegeben.
Und als ob das nicht genug wäre, da kommen manche und drücken sich noch umständlicher aus: man sagt nicht: er siegte, sondern er trug den Sieg davon, da man ja beim Sieg meistens etwas wegträgt: einen Pokal, einen Scheck oder beim Fußball die drei Punkte. Man bestreitet auch nicht irgendetwas, sondern stellt es in Abrede. Auch nicht »betrachten«, sondern in Augenschein nehmen. Man schweigt ja auch nicht, das wäre einfach und ordinär, sondern es wird »Stillschweigen gewahrt.« Sie sagen nicht: "Rauchen und Trinken sind schädlich ", sondern »Das Rauchen und Trinken führt in gesundheitlicher Hinsicht zu einer großen Beeinträchtigung«, halleluja. Wer bei ihnen das Einfache einfach sagt oder schreibt, ist unten durch. Das Einfache muss so formuliert werden, dass keiner es versteht, das zeugt von Geist, beschert Bewunderungen. Gerade hier drückt sich die ganze Schwere ihres komplizierten Charakters aus. Sie neigen zum Abstrusen, zum Unergründlichen, zu Preziosität wie einer ihrer Sprachvirtuosen konstatierte. Sie lieben einfach das »Absolute«, so ist keiner nur »überzeugt«, sondern restlos überzeugt, also nicht nur ein bisschen überzeugt, sondern total. Es gibt keine Wahrheit, sondern die »nackte Wahrheit«, manchmal ist sie sogar rein, also hat vorher gebadet und natürlich gibt es auch brennende Fragen, da sollte man sich in Acht nehmen und einen Feuerlöscher in der Nähe haben. Ihre Bücher sind von einer Schwere belastet, die die Schwere ihres Gemütes widerspiegelt. Warum soll man einfacher schreiben, wenn es komplizierter geht, pflegen sie schmunzelnd zu sagen. Hätten sie sich bloß an die Maxime eines ihrer eigenen Philosophen gehalten, der sagte: »Wer klar denke, der könne sich auch klar ausdrücken.« Liest man eines dieser Bücher, so hat man das Gefühl, der Autor ist gar nicht daran interessiert, einem etwas beizubringen. Ihm ist es einerlei, ob man überhaupt etwas kapiert, wichtig für ihn ist, sein unermessliches, harterworbenes Wissen auszubreiten, seine Gelehrsamkeit an den Tag zu legen. Als Leser hat man ihn zu bewundern und in Ehrfurcht vor seiner Gelehrtheit zu erblassen.
Stellenweise ist die Sprache gewalttätig, in ihr spiegelt sich das Militärische wider: sie springen in die Bresche, halten die Fahne hoch, heben jemanden aus dem Sattel und setzen den Fuß auf dessen Nacken, aber vorsichtig sind sie ja und verschießen selten ihr ganzes Pulver auf einmal. Bevor sie kämpfen, werfen sie die Handschuhe weg, was ich für unsinnig halte, warum sollte man die Handschuhe wegwerfen, wenn sie noch gut zu gebrauchen sind? Sie sprechen vom Umklammerungsgesetz (z.B. hat ... geholfen) als handele es sich um einen Ringkampf. Abgehärtet sind sie schon, sie essen sogar Splitterbrötchen ohne Handschuhe.
Sprachliche Absurditäten bilden ein Kapitel für sich, da kommt es schon vor, dass jemand von der »treulosen Tomate« redet. Ich zerbrach mir eine Weile den Kopf darüber, wie eine Tomate treulos sein kann, da diese Eigenschaft für Frauen reserviert ist. Ist einer nah am Explodieren, geht er die Wände hoch und läuft Gefahr, sich auch noch den Hals zu brechen, und wenn sie genug haben, lassen sie die Kirche im Dorf, als ob man die mitnehmen könnte, dann streiten sie um des Kaisers Bart, vermutlich noch bevor der gestorben ist. Und wenn sie es sich einmal gut gehen lassen, lassen sie die Sau raus, da fragt man sich als neutraler Beobachter, warum sie sie eingesperrt haben, oder sie lassen die Fünf auch mal eine gerade Zahl sein, ist das nicht ein mathematischer Pfusch? Haben sie jemanden lieb, gehen sie mit ihm Pferde stehlen und sorgen dafür, dass er im Gefängnis landet. Das ist doch eine Gemeinheit, nicht wahr? Wenn sie jemandem Beistand leisten wollen, sagen sie »Hals und Beinbruch«, sie hoffen also auf dessen totale Vernichtung.
Überhaupt reden sie sehr eigenartig und meines Erachtens total unlogisch. Will einer von denen, dass ich mir etwas merken soll, da sagt er, ich soll mir das hinter die Ohren schreiben. Ist das nicht merkwürdig? Erstens ist der Platz hinter den Ohren viel zu klein, um sich ein paar vernünftige Sätze notieren zu können und würde man diese herkulische Aufgabe bewältigen, könne man doch das Notierte kaum lesen, auch nicht mit Hilfe eines Spiegels. Mit solchen ausgefallenen Forderungen verkomplizieren sie alles und verhindern, dass man ihren Wünschen nachkommt. Um all das aufzunehmen, wozu ich aufgefordert werde, müsste der Platz hinter den Ohren unendlich groß sein, größer als ein Fußballplatz. Im Englischen finde ich es dagegen viel netter, da sagen sie: »Put that into your pipe and smoke it.« Ist das nicht ein herrlicher Vorschlag, vernünftig und realitätsnah? Auch für Nichtraucher durchaus akzeptabel.“
So kam Fanus, das Wüstenprodukt, zu der Erkenntnis, dass er es doch mit einer sehr schönen aber eben einer sehr schweren Sprache, die sich kaum beherrschen lässt, zu tun hat. Bei ihr vermisst man das Leichte, das Melodische der romanischen Sprachen, die Italiener reden nicht, sie singen. Das mag am Konsonantenreichtum liegen. Man sagt, die deutsche Sprache »sei wie ein Urwald, dicht und geheimnisvoll, ohne großen Durchgang und doch tausendpfadig.« Sie hat etwas Rauhes und Ungehobeltes.
Nach seiner Ankunft und nach dem grünen Schock schlenderte Fanus durch die Straßen ziel- und orientierungslos. Er schaute sich um und erwartete, dass jemand auf ihn zukommt und ihn willkommen heißt. Er wusste ja, ein ungeschriebenes Gesetz bei denen lautete: »zwischen einem Bekannten und einem Unbekannten, was das Recht des Gastes anlangt, macht niemand einen Unterschied.« Und ein weiteres Gesetz: »irgendjemanden, wer es auch sei, von seinem Haus abzuweisen, wird für frevelhaft gehalten.« Ach, die Gesetze müssen sie geändert haben, stöhnte er. So stand er auf dem Boulevard und sah aus wie ein Grieche unter Barbaren. Er hörte sich ihr wirres Gebrumm an und dachte: „An sich ist dieses Nicht-Verstehen ein Segen: man könnte von jedem beschimpft und zur Sau gemacht werden und würde alles mit einem Lächeln quittieren.“ Er war aber nicht der Grieche, sondern eher der Barbar; denn seine wirren Augen machten den Eindruck eines Irrenhausentflohenen, der sich über den regen Verkehr wundert. Sein Magen knurrte und keiner lud ihn zu einer Mahlzeit ein. „Leute, was ist das denn für eine Gastfreundschaft! Es ist wirklich nicht nötig für mich gleich ein Schaf zu schlachten, ein Huhn oder eine Ente würde auch reichen. Ich bin Fanus, der Sohn von Abu Fanus und Um Fanus. Sie sind leider Gottes beide tot und schauen jetzt von dort oben auf mich herab, was sollen sie von Euch denken, wenn sie sehen, dass Ihr gar nicht so nett seid zu ihrem Kindchen? Fanus heißt übrigens Laterne. Ich bin also eine Leuchte, ich leuchte sogar nachts wie ein Salamander. Allah, wo bist Du?“ schrie er laut wie Faust nach Helena. Weit und breit war kein Huhn zu sehen, weder lebendig noch gebraten, stattdessen lauter Gäste: braune, gelbe, weiße, schwarze, dicke, dünne... und es schien so, als gäbe es mehr Gäste als Gastgeber. Er vergaß dabei, dass viele Gäste die Freundschaft verderben und es waren viele da, die an ihm vorbeigingen und alles andere als edel aussahen, erschreckend viele. Er erwartete großgewachsene, trotzige Kerle mit blauen Augen und rötlichen Haaren, sah stattdessen viele schwarzhaarige und eine Anzahl ganz ohne Haare, glattrasiert. Dieser Mischmasch irritierte ihn.
Einer der ersten Worte, deren Sinn Fanus begriffen hat, war das Wort »Scheiße«. Zuerst wunderte er sich gar nicht darüber, wie häufig das Wort »Scheiße« vorkommt; denn er hatte einmal in einem Buch gelesen, dass bei diesem an sich so sauberen Volk das Wort »Scheiße« das meistgebrauchte Wort ist. In der Tat, man bekommt es wirklich permanent zu hören. In diesem Lande gebrauchen die Menschen gern knusprige Begriffe, die man nicht nur hört, sondern auch riecht. Im Grunde genommen ist ihnen alles »scheißegal«, auch wenn dem nicht so ist. Sie »scheißen« auf alles und Ausländer sind »Scheißdreck«. Überhaupt ist alles »verdammte Scheiße« und das ganze Leben ist ohnehin eine »große Scheiße«. Dann aber fragte er sich, ob die Sprache an anderen Fluchworten arm ist oder ob diese womöglich nicht so gut riechen? Bei der kleinsten Beleidigung oder unachtsamen Bemerkung wird man freundlichst aufgefordert, den Arsch des Beleidigten zu lecken. Sogar der Dichterfürst ließ seinen Götz dem Hauptmann ausrichten, er möge ihn »im Arsch lecken«. Wenn man tapfer sein soll, muss man die »Arschbacken zusammenkneifen«; dann »dampft die Kacke«, als handele es sich um wohlschmeckende Speise. Will man jemanden beeindrucken, prompt bekommt man die Frage zu hören: Ist das auf deinem Mist gewachsen? Was heißen soll, hast du es selbst geschissen? Will man zwischen Streithähnen schlichten, wird man aufgefordert, sich lieber um den eigenen Dreck zu kümmern.
Читать дальше