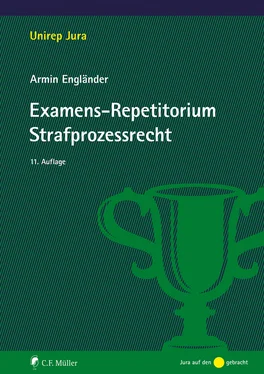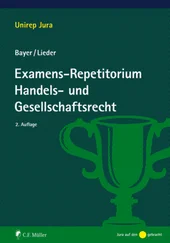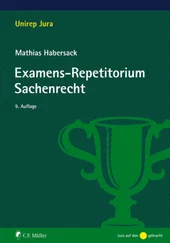2 Freilich harmonieren diese Ziele nicht notwendig miteinander; sie können u.U. auch miteinander in Konflikt geraten. Fall 1a: A ist angeklagt, seine Ehefrau getötet zu haben. Da die Leiche niemals gefunden wurde, kommt als einziges Beweismittel ein Zeugenbeweis durch den Polizisten P in Betracht, demgegenüber A nach Dunkelhaft und ständigem Stören im Schlaf ein – später widerrufenes – Geständnis abgelegt hatte. Lösung: Hier besagt die Regelung des § 136a Abs. 1, Abs. 3 S. 2 StPO (verbotene Vernehmungsmethoden), dass das Geständnis des A nicht verwertet werden darf. Das Ziel der Wahrheitsfindung muss damit hinter das kollidierende Ziel eines rechtsstaatlichen Verfahrens zurücktreten. A wäre demzufolge freizusprechen. Fall 1b: Jahre später brüstet sich der rechtskräftig freigesprochene A gegenüber seinem Freund F damit, seine Ehefrau getötet und die Leiche beseitigt zu haben, ohne dass ihm die Ermittlungsbehörden auf die Schliche gekommen seien. Lösung: Hier ist nach § 362 Nr. 4 StPO ausnahmsweise eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu Ungunsten des A zulässig. Die Urteilsgrundlage gilt in einem solchen Fall als so erschüttert, dass das Ziel eines fortdauernden Rechtsfriedens durch eine rechtskräftige Entscheidung hinter dem Ziel der Wahrheitsfindung zurückstehen muss. A könnte so in einer neuen Hauptverhandlung wegen Totschlags oder Mordes verurteilt werden.
Ziele des Strafverfahrens I. Ziele des Strafverfahrens 1 Das materielle Strafrecht bestimmt, welche Verhaltensweisen als Straftat gelten und mit welchen Sanktionen sie geahndet werden sollen. Hingegen regelt das Strafprozessrecht, auf welche Weise das Vorliegen einer Straftat ermittelt und die Strafverfolgung durchgesetzt wird. Dabei dient das Strafverfahren drei grundlegenden Zielen: - Wahrheit: Niemand soll zu Unrecht bestraft werden. Das Strafverfahren bezweckt die Feststellung des Sachverhaltes, wie er sich tatsächlich abgespielt hat, um auf dieser Grundlage eine materiell-rechtlich richtige Entscheidung treffen zu können. - Rechtsstaatlichkeit: Niemand soll unverhältnismäßigen Eingriffen und einem Missbrauch staatlicher Machtmittel ausgesetzt werden. Das Strafverfahren bezweckt daher eine rechtsstaatliche Steuerung der Strafverfolgung. - Rechtsfrieden: Das Strafverfahren soll schließlich durch eine abschließende verbindliche Entscheidung die Geltung der Rechtsordnung bekräftigen und dadurch Rechtsfrieden schaffen. 2 Freilich harmonieren diese Ziele nicht notwendig miteinander; sie können u.U. auch miteinander in Konflikt geraten. Fall 1a: A ist angeklagt, seine Ehefrau getötet zu haben. Da die Leiche niemals gefunden wurde, kommt als einziges Beweismittel ein Zeugenbeweis durch den Polizisten P in Betracht, demgegenüber A nach Dunkelhaft und ständigem Stören im Schlaf ein – später widerrufenes – Geständnis abgelegt hatte. Lösung: Hier besagt die Regelung des § 136a Abs. 1, Abs. 3 S. 2 StPO (verbotene Vernehmungsmethoden), dass das Geständnis des A nicht verwertet werden darf. Das Ziel der Wahrheitsfindung muss damit hinter das kollidierende Ziel eines rechtsstaatlichen Verfahrens zurücktreten. A wäre demzufolge freizusprechen. Fall 1b: Jahre später brüstet sich der rechtskräftig freigesprochene A gegenüber seinem Freund F damit, seine Ehefrau getötet und die Leiche beseitigt zu haben, ohne dass ihm die Ermittlungsbehörden auf die Schliche gekommen seien. Lösung: Hier ist nach § 362 Nr. 4 StPO ausnahmsweise eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu Ungunsten des A zulässig. Die Urteilsgrundlage gilt in einem solchen Fall als so erschüttert, dass das Ziel eines fortdauernden Rechtsfriedens durch eine rechtskräftige Entscheidung hinter dem Ziel der Wahrheitsfindung zurückstehen muss. A könnte so in einer neuen Hauptverhandlung wegen Totschlags oder Mordes verurteilt werden.
1, 2
II. Quellen des Strafverfahrens 3
III. Gang des Strafverfahrens 4, 5
§ 2 Die Prozessvoraussetzungen
I. Wichtige Prozessvoraussetzungen 6 – 8
II. Fehlen von Prozessvoraussetzungen 9, 10
§ 3 Die Prozessmaximen
I. Das Rechtsstaatsprinzip 11
II. Das Offizialprinzip 12 – 15
1. Inhalt 12
2. Die Antragsdelikte 13
3. Die Ermächtigungsdelikte 14
4. Die Privatklagedelikte 15
III. Das Akkusationsprinzip 16
IV. Das Legalitätsprinzip 17 – 19
1. Inhalt 17
2. Außerdienstlich erlangtes Wissen 18
3. Die Bindung der StA an die höchstrichterliche Rechtsprechung 19
V. Der Untersuchungsgrundsatz (Ermittlungs- oder Instruktionsprinzip) 20
VI. Der Unmittelbarkeitsgrundsatz 21
VII. Das Mündlichkeitsprinzip 22
VIII. Der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung 23, 24
1. Inhalt 23
2. Das Schweigen des Angeklagten 24
IX. Der Grundsatz „in dubio pro reo“ 25
X. Der Grundsatz der Öffentlichkeit 26, 27
XI. Der Beschleunigungsgrundsatz 28, 29
XII. Das Prinzip „nemo tenetur se ipsum accusare“ 30
XIII. Der Grundsatz des fairen Verfahrens (fair trial) 31
§ 4 Die Gerichtszuständigkeit und -organisation
I. Die sachliche Zuständigkeit in der ersten Instanz 32 – 41
1. Das Amtsgericht 33 – 36
2. Das Landgericht 37 – 39
3. Das Oberlandesgericht 40, 41
II. Die örtliche Zuständigkeit in der ersten Instanz 42, 43
III. Die Zuständigkeit in Rechtsmittelverfahren 44 – 46
IV. Die Zuständigkeit des EGMR 47 – 49
§ 5 Die Verfahrensbeteiligten
I. Die Staatsanwaltschaft 50 – 55
1. Die Organisation der StA 51 – 53
2. Die Reichweite der Weisungsgebundenheit 54
3. Die Ablehnbarkeit eines StA wegen Besorgnis der Befangenheit 55
II. Die Polizei 56, 57
III. Der Beschuldigte 58 – 67
1. Der Beschuldigtenstatus 58, 59
2. Die Pflichten des Beschuldigten 60
3. Die Rechte des Beschuldigten61 – 67
IV. Der Verteidiger 68 – 79
1. Der Verteidigerstatus 68
2. Die Pflichten des Verteidigers69 – 71
3. Die Rechte des Verteidigers 72 – 76
4. Wahlverteidiger und Pflichtverteidiger 77
5. Das Verbot der Mehrfachverteidigung 78
6. Der Ausschluss des Verteidigers 79
V. Der Zeuge 80 – 88
1. Der Zeugenstatus 80
2. Die Pflichten des Zeugen 81 – 81
3. Die Rechte des Zeugen 84 – 88
VI. Der Sachverständige 89 – 91
VII. Der Verletzte 92
VIII. Der Richter 93 – 95
1. Der Ausschluss 94
2. Die Ablehnung 95
§ 6 Das Ermittlungsverfahren
I. Die Einleitung 96, 97
II. Die Durchführung 98 – 105
1. Die Vernehmung des Beschuldigten 100 – 102
2. Die Einschaltung des Ermittlungsrichters 103 – 105
III. Der Abschluss 106 – 113
1. Die Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts 106
2. Die Einstellung mangels öffentlichen Interesses 107
3. Die Einstellung aus Opportunitätsgründen 108 – 111
4. Klageerhebung 112, 113
IV. Das Klageerzwingungsverfahren 114 – 116
§ 7 Die Zwangsmittel
I. Die Untersuchungshaft 117 – 125
1. Die Voraussetzungen 118 – 121
2. Der Ablauf 122 – 124
3. Der Rechtsschutz 125
II. Die vorläufige Festnahme 126 – 132
1. Das Jedermann-Festnahmerecht 127 – 130
a) Die Voraussetzungen127, 128
b) Der Umfang des Festnahmerechts 129, 130
2. Das Festnahmerecht für StA und Polizei 131
3. Die Richtervorführung 132
III. Die körperliche Untersuchung des Beschuldigten 133 – 135
IV. Die molekulargenetische Untersuchung 136 – 138
V. Maßnahmen gegen Dritte 139
VI. Die Sicherstellung 140 – 144
1. Die Beschlagnahme 141, 142
2. Die Führerscheineinziehung 143
3. Die Beschlagnahme von Postsendungen 144
VII. Die Überwachung der Telekommunikation 145 – 149
1. Die Voraussetzungen 145 – 147
Читать дальше