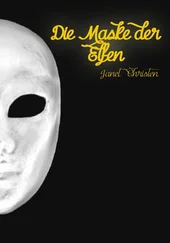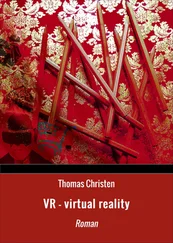Einem seltsamen Impuls folgend schaue ich auf meinen weinbefleckten Hosensaum und höre einen Moment lang nicht zu. Ich weiß nicht, ob er die Skepsis bemerkt, die sich auf mein Gesicht zu legen beginnt. Ich glaube aber nicht, denn er erzählt wie in einer Art rasant ansteigendem Fieber.
„Und Schiller, in seinem grenzenlosen Glücksgefühl, ruft: «Eine Libation für die Götter! Gießen wir unsere Gläser aus». Und als er das wirklich macht, tun es ihm Christian Körner und die anderen Gäste nach. Und Schiller nimmt die leeren Gläser und wirft sie über die Gartenmauer, wo sie scheppernd auf dem Steinpflaster zerschellen. «Keine Trennung! Keiner allein! Sei uns ein gemeinsamer Untergang beschieden!», schreit er in einem Ausbruch unbeschreiblicher Leidenschaft...“
Ich höre mich tief ausatmen, aber er schweigt einen Augenblick und spielt gedankenverloren am Stiel seines Glases.
„Und ein paar Wochen später vollendet er an diesem Ort Die Ode an die Freude , die er, das am Rande, auf einen Vorschlag Körners begonnen hatte. Und deren Qualität er, bemerkenswerterweise, wenige Jahre später auf das Heftigste relativierte. Wie es übrigens auch Beethoven mit eben jenem vierten Satz seiner 9. Symphonie gemacht hat. Ein für den Autor unbefriedigendes Gedicht und ein kompositorischer Missgriff verschmelzen zu einem die Jahrhunderte überdauernden, erhabenen Monument ...“
Er schüttelt den Kopf und lächelt.
„Beethoven und Schiller sind sich nie persönlich begegnet ...“
Er sieht mich an und bemerkt meinen fragenden, und ja, ich gebe es zu, mehr als zweifelnden Blick. Wir sitzen hier im Grunde aus purem Zufall. Wir waren im gleichen Konzert. Gut. Aber warum erzählt er mir das alles in einer solchen Ausführlichkeit? Wein wurde zu allen Zeiten verschüttet, Unachtsamkeit ist ein Teil des menschlichen Wesens und euphorische Träumer gibt es auf dieser Welt wie Sand am Meer. Sie sorgen dafür, dass mein Konto nicht immer wieder hoffnungslos in die Miesen rutscht.
„Sie glauben mir nicht, nicht wahr? Sie halten mich für einen Schwätzer. Einen einsamen Schwätzer. Einen einsamen alten Schwätzer ...“
Ich hebe entschuldigend die Hände und bin mir sicher, dass er die Unwahrheit in meiner antwortenden Geste sofort heraushört.
„Es ist eine reizende Geschichte. Und sie ist ein wunderbarer Abschluss dieses denkwürdigen Abends. Haben Sie vielen Dank, aber ich muss jetzt wirklich ...“
„... Es ist keine Geschichte, mein Freund! Es ist die Wahrheit! Die W-a-h-r-h-e-i-t! Und wie ich Ihnen schon sagte: mir liegt unendlich viel an Wahrheit und Ehrlichkeit. Die Freude ist beileibe nicht nur das, wofür sie viele halten, keine prärevolutionäre, männerbündlerische, romantisch überhöhte, kitschüberzogene, dem, dem, dem ...“, er beginnt mit den Händen vor seinem Gesicht herum zu wedeln, „ ... dem zu Melodramatik neigenden Charakter eines verarmten Poeten zuzuschreibenden ... sie ist ein Schrei! Ein Schrei nach ... das absolut sichere Gefühl, die unumstößliche Gewissheit eins zu sein mit anderen, ja mit der Natur, in seinem Streben und Denken, die Erhabenheit, die ...“
„ Bitte! Bitte beruhigen Sie sich. Ich weiß nicht, für wen Sie mich halten, aber ich bin ganz sicher nicht ...“
Ich lege meine Hand auf die Tischdecke, als könne diese Geste bewirken, dass unsichtbare Ströme eines Sedativums durch den weißen Stoff fließen, aus ihm herausströmen, um ihn dann wie beruhigender Nebel einzuhüllen. Er betrachtet mich mit dem Blick eines maßlos enttäuschten Lehrers, der es soeben aufgegeben hat, seinem Schüler die Wunder der menschlichen Seele zu vermitteln.
„Nein, nein, Sie sind auch nur einer jener abertausend Scharffensteins, gegen dessen Spötterei der Dichter schrieb: Wie wenig Achtung, Liebe Du für mich hegtest, wie klein Du mein Herz gefunden. Die Seele verschweißt. Aus Privilegien erwachsene Blindheit, Höflinge des Mittelmaßes,“ flüstert er.
„Glauben Sie mir, ich habe so viel verloren. Aber böte man es mir an: ich wollte es nicht zurück!“
Ich stehe auf. Diese Unterhaltung hat Formen angenommen, mit denen ich nicht mehr zurechtkomme. Seine letzten Tiraden und Anschuldigungen nehme ich nicht ernst. Wem, oder was sie geschuldet sind, will ich nicht wissen. Ich bin kein Psychologe, geschweige denn Psychiater. Eine gewisse Portion Menschenkenntnis und Empathie verlangt mein Job. Aber eine solche Breitseite an Pathos erinnert mich – ja, an was? Ich muss zugeben, dass in den Untiefen meines Verstandes kurz etwas zu brodeln beginnt, an das ich einfach nicht erinnert werden will. Das Knarren der Stuhlbeine klingt wie Geräusche aus einer anderen Welt.
„Machen Sie es gut und nochmals vielen Dank.“
Ich nehme meinen Mantel von der Garderobe und nicke ihm im Vorbeigehen noch einmal zu. Aber er reagiert nicht und rezitiert leise etwas vor sich hin, das ich nicht verstehe. ... nie gekonnt, der stehle weinend sich ... An der Tür angelangt ziehe ich den erstbesten Schirm aus dem Ständer und trete auf den nassglitzernden Gehweg. Das Gewitter und der Sturm haben nachgelassen. Vereinzelt weht eine tropfendurchtränkte Böe heran. Ich spanne den Schirm auf und überlege, wo die nächste Bushaltestelle liegt. Der 810er fährt um diese Zeit noch alle halbe Stunde. Als ich an der Haltestelle ankomme und unter dem Wartehäuschen den Schirm zuklappe, wird mir bewusst, dass ich gar keinen eigenen Schirm mitgenommen hatte. Ich bin also ein Dieb! Aber ich werde das Ding unter keinen Umständen zurückbringen. Und ich verspüre nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Schirme sind Werbeartikel. Es gibt sie, wenn nicht an jeder, dann an jeder zweiten Ecke. Streuware. Ich weiß wovon ich rede. Die Sprüche zur mediopharm-Aktion vor zwei Jahren waren auf meinem Mist gewachsen: Damit Sie die nächste Grippewelle nicht nass macht! Und zehn Sekunden lang war ein unsäglich bescheuerter blauer Bär aus der Feder unseres AD über den Bildschirm gehüpft und hatte einen ebenso blauen Riesenschirm geschwungen. Eine Windböe weht die durchweichte Hälfte einer Yoghurtverpackung an die tropfenübersäte Außenwand des Wartehäuschens und ich schlage den Kragen meines Mantels hoch.
... Ja, wer auch nur eine Seele, sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer’s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!
Warum? Warum fällt mir diese Stelle ein? Jetzt? Hat er eben irgendwann aus dem Gedicht zitiert und ich habe es nicht bemerkt, weil ich mit meinen Gedanken woanders war? Haben mich seine letzten kruden Bemerkungen doch irgendwie auf verschlungenen Wegen erreicht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie lang das ganze Gedicht ist. Hat der Chor diesen Teil in der Kirche gesungen?
Der 810er aus der Gegenrichtung kommt und hält auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es gibt nur einen Fahrgast. Eine junge Frau, direkt hinter dem Fahrer. Sie starrt durch die Scheibe ins Nichts und lauscht dem, was aus den Kopfhörern kommt, die sie aufhat. Durch meinen Kopf weht das Bild meiner Frau, Rauch, aber klar zu erkennen. Es wabert, verschwindet und kehrt zurück, verwandelt sich in den Rücken meiner mehr als befremdlichen Bekanntschaft von eben. Die Kirchenbank vor mir. Ein hellblaues Hemd. Und urplötzlich die Gesichter von Carsten und den anderen Kollegen. Noch bevor ich mich fragen kann, woher diese nächtlichen Geisterbilder jetzt kommen, höre ich das Rauschen des nahenden Busses und der Gedankenspuk ist vorbei. Ich setze mich vor den Ausgang in der Mitte und hole mein Handy hervor. Keine Mitteilungen. 22.15 Uhr und der Akku auf 9 Prozent.
... Festen Mut in schweren Leiden, Hilfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwor’nen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind ... Verschwindet! Irgendjemand, irgendetwas spielt mit mir. Der Bus setzt sich in Bewegung und mir fällt in diesem Moment auf, dass wir uns nicht einmal namentlich vorgestellt haben.
Читать дальше