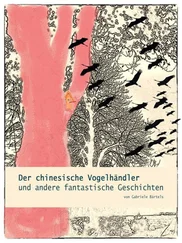„Der Tee ist gleich fertig,“ sagte sie und der Verbrecher sah hoch.
Zum ersten Mal schaute er in ihre Augen, blaue, klare, blitzende Augen über einem breiten, roten Brillengestell, das ein schmales Gesicht umklammerte. Er glitt von ihrem ruhigen Blick ab, als hätte er den Halt verloren. Die alte Frau trug nun weiße Hosen, mit einem gestreiften T-Shirt darüber, sie hatte die Haare zu einem Zopf geflochten, ein schweres, grobes, weißgoldenes Kettenarmband rutschte ihr fast vom dürren Handgelenk. Der Blick des Verbrechers blieb daran hängen.
„Das will ich haben,“ sagte er und streckte seine Hand aus.
Die Frau drehte sich um und ging in die Küche. Der Verbrecher folgte ihr. Er stieß gegen die Lampe, die über dem Tisch hing, und der Lichtschein schaukelte hin und her.
„Ich habe nur Teebeutel,“ sagte die Frau zu dem kochenden Wasser und übergoss diese damit.
Der Verbrecher sagte: „Das Armband.“
Die alte Frau öffnete den Verschluss und die schwere Kette glitt von ihrem Handgelenk auf die Anrichte, wo es zusammengeringelt liegenblieb.
Der Verbrecher griff nicht danach, sondern legte seine großen Hände neben ein Messer auf dem Tisch. Sie schoben einen Teller beiseite. Die Rechte und die Linke nahmen einander in die Hand, streichelten sich, lösten sich wieder. Ein Zeige- und ein Ringfinger trommelten auf der weißen Tischplatte, blieben liegen, zuckten einmal hoch. Die Hände falteten sich zusammen und die Fingerknöchel wurden weiß. Die Linke griff nach dem Messer und ritzte einen langen Strich in die Platte, dann noch einen, quer dazu. Die alte Frau stellte die Teekanne daneben, der Verbrecher berührte mit dem Handrücken das heiße Porzellan und zuckte zurück. Das Messer fiel mit einem Klirren auf die Kacheln. Aus dem Schlafzimmer bellte der Hund.
Er bückte sich und hob das Messer auf.
Die alte Frau streckte ihre Hand aus und sagte: „Geben Sie her. Der Boden ist voller Hundehaare. Ich hole Ihnen ein neues.“
Der Verbrecher sah auf die fleckige, braune Hand. Dann legte er langsam das Messer hinein. Seine Finger berührten die alte Haut nicht.
Die Frau griff nach einem Block aus Holz, in dessen Schlitze Messer aller Größen bis zum Heft steckten und zog das längste heraus. Die Schneide war gezackt und blitzte.
„Hier,“ sagte sie und legte es neben ihn auf die andere Seite des Tellers. Sie lächelte. „Du bist doch Linkshänder.“
Der Verbrecher wurde rot. „Duzen Sie mich gefälligst nicht!“, sagte er, sprang so heftig auf, dass der Stuhl nach hinten umkippte und griff nach dem Armband auf der Anrichte. Er ließ es in die Tasche gleiten und sagte: „Das habe ich schon mal.“
Die Frau goss Tee ein. Sie wies mit der Handfläche auf den umgekippten Stuhl und sah den Verbrecher einladend an. Der bückte sich, hob den Stuhl auf und setzte sich. Ihm gegenüber nahm die Frau Platz. Ihre Blicke trafen sich auf gleicher Höhe.
Die Frau goss Kaffee ein. Sie schüttete einen Löffel Zucker nach dem anderen in ihre Tasse, rührte klingelnd um, nahm den Löffel zwischen ihre faltigen Lippen und leckte ihn ab.
„Fünf Löffel Zucker?“, fragte der Verbrecher, hinter jedes Wort ein Ausrufezeichen setzend.
Die alte Frau zuckte mit den eckigen Schultern und griff nach dem Brot. Die Hände des Verbrechers legten sich um die Teetasse, als sei sie ein rohes Ei. Er trank schlürfend, schaute die Frau an und grinste. „Sie glauben doch nicht, dass ich Mitleid mit Ihnen habe.“
Die alte Frau schluckte das Brot hinunter und sagte: „Nein.“
„Wo sind Ihre Sparbücher?“
„Im Wohnzimmer. Zweite Schranktür rechts oben, in einem Spielekasten.“
Der Verbrecher kicherte: „Was haben Sie sonst noch, was sich lohnt?“
Die alte Frau krauste die Stirn.
„Das kommt darauf an, ob Sie mit dem Wagen da sind oder mit dem Bus. Die Stereoanlage, der Fernseher. Ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Der Maler wird Ihnen kaum etwas sagen.“
„Was ist mit Schmuck, Bargeld, Schecks?“
„Alles in dem Spielekasten.“
Der Verbrecher stand auf. Das Messer nahm er mit. „Nur zur Sicherheit,“ sagte er.
Die alte Frau räumte den Tisch ab. Schranktüren klappten auf und zu, dann erschien der Verbrecher mit dem bunten Spielekasten wieder in der Küche. Auf dem Pappdeckel klebte das Foto einer Familie, sie ließen lächelnd Würfel rollen. Oben auf lag das Messer. Er stellte den Karton auf den Tisch und öffnete ihn. Er räumte Mensch-Ärger-Dich-Nicht- und Schachspiel-Bretter beiseite, ließ sie einfach fallen, schaufelte mit beiden Händen rote, grüne und blaue Halmafiguren heraus, schwarze und weiße Schachfiguren, einen Würfelbecher, Dame-Steine. Darunter lagen lange Goldketten, ein Ehering, eine Brosche, Reiseschecks und drei blaue Postsparbücher. Der Verbrecher blätterte sie auf, suchte nach der letzten Eintragung, klappte sie wieder zu und sagte: „Yep!“
Die alte Frau reichte ihm eine leere Plastiktüte. Er füllte alles hinein und drückte seine Beute an sich. Die alte Frau stellte die benutzten Tassen in die Spüle. Der Verbrecher räusperte sich.
„Ich gehe,“ sagte er.
Sie nickte und wischte sich die Hände an einem Handtuch ab. Der Verbrecher betrat das Schlafzimmer, setzte sich auf das Bett und zog seine Schuhe darunter hervor. Er stellte seine Füße hinein und beugte sich nach dem unsichtbaren Hund.
„Tschüs, Köter,“ zischte er.
Vor der Garderobe rief er: „Danke für den Tee.“
Er ließ die Tüte auf den Boden sinken, griff nach seiner Jacke und zog sie an.
Als er sich nach der Tüte bückte, traten die nackten Füße der alten Frau leise in sein Blickfeld. Eine Messerklinge blitzte auf.
„Sie könnten mir mal eben helfen,“ sagte die alte Frau auf ihn herunter. „Zu Mittag will ich den Hund braten. Würden Sie ihm das Fell abziehen?“ Ihre Augen schauten ruhig über den Rand der Brille.
Der Verbrecher schlug ihr das Messer aus der Hand und riss die Wohnungstür auf.
Er keuchte, als er die Treppe herunterflog, stolperte, fing sich, brach sich dabei den kleinen Finger, merkte es nicht. Der Hund spitzte die Ohren und lauschte ihm nach. Die alte Frau drückte die Tür zu und hob die Tüte mit ihren Wertsachen auf.
Amoklauf
Ich bin ein durchschnittlicher Großstadtmensch. Einer, den Sie morgens in tausendfacher Ausführung in der S-Bahn, U-Bahn, in den Bussen sitzen sehen können. Morgens riecht die S-Bahn gut. Wir Fahrgäste sind frisch gewaschen, geschminkt, rasiert, fahren im Halbschlaf oder Zeitung lesend in die Nähe unserer Arbeitsplätze und legen den Rest zu Fuß zurück, eine Brötchentüte unter dem Arm. Mit einem Ruck stoßen wir die schweren Glastüren zu unseren Bürogebäuden auf, es sei denn, sie sausen von selbst auseinander. Wir residieren im ersten, zweiten oder dritten Stock und könnten die Etagen nicht auseinanderhalten, wären sie nicht nummeriert. Alles genau wie gestern: Weiße Wände mit Schrammen in Kniehöhe, das verquollene Gesicht des Kollegen, der sich in der Teeküche seinen ersten Magentee braut. Der kaputte Kopierer, der Staubschutz auf der Tastatur, die fünf Handgriffe: Computer einschalten, Fenster auf, Pflanze gießen, Schreibtischlampe ausrichten, Passwort eingeben. Es macht „Kling“. Da bin ich, und ich hasse es. Zumal ich mit einer Kollegin das Zimmer teile, die andere Vorstellungen von frischer Luft hat als ich.
Heute tat ich dann Folgendes: Ich schlug ihr den dämlichen Schädel ein, als sie mich darum bat, das Fenster wieder zu schließen. Dann schloss ich das Fenster, nahm meine Pflanze unter den Arm und verließ meinen Arbeitsplatz für immer. Wie dramatisch mein Abgang war, bemerkte niemand. Die Mitarbeiter in den anderen Büros drehten sich nicht um. Sie dachten wohl, ich hätte einen frühen Außentermin.
Erstaunlich, wie radikal man durch so einen Schritt aus seinen Verhältnissen katapultiert wird. Eben war es noch selbstverständlich, ein Bürger mit einer Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr zu sein, der das Recht hat, sich an jedem Kiosk der Stadt eine Illustrierte für die Mittagspause zu kaufen. Nun ist nicht mehr sicher, ob der Polizist gegenüber vor dem Zeitschriftenladen steht, weil er alarmiert wurde. Aber den kann man ja abschütteln.
Читать дальше