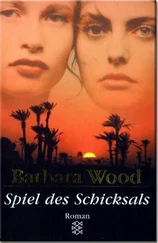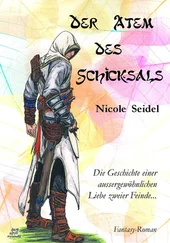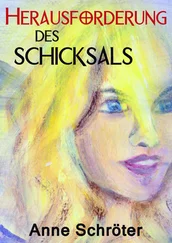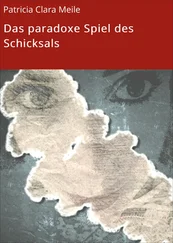Karen starrt Sandra an, als sei dieser gerade ein Geweih gewachsen. „So plötzlich? Wie damals, als du einfach so nach Berlin abgehauen bist?“
„Oma, ihr habt gesagt, ich kann nur eine Woche hierbleiben. Was soll das jetzt? Ich werde zu Gwynn ziehen, und alle sind zufrieden.“
„Die Woche ist noch nicht rum“, erklärt Brian. „Es kommt halt einfach sehr plötzlich für deine Oma. Sie hat es noch nicht verkraftet, was damals geschah.“
„Ich kann für mich allein reden“, flickt Karen ein. „Aber dein Opa hat recht.“ Karen ringt mit den Tränen.
„Da siehst du, was du angerichtet hast“, schimpft Brian. „Musstest du auch wieder hier auftauchen? Konntest du nicht bleiben, wo der Pfeffer wächst, nachdem du dich über zehn Jahre lang nicht gemeldet hast?“
Sandra ist wie vor den Kopf gestoßen. „Ihr wisst nichts, gar nichts“, sagt sie leise, um sich unter Kontrolle zu haben. „Ja, ich bin nach Berlin gegangen, und ja, ich habe nichts von mir hören lassen. Das tut mir sehr leid. Aber hört mir bitte zu, ich möchte es erklären, damit diese Sache ein für alle Mal aus der Welt geschafft wird. Darf ich anfangen?“
Brian zuckt mit den Schultern, und Karen sagt: „Von mir aus. Vielleicht bringt es ja wirklich Ruhe ins Haus. Also?“
„Ich hatte den Eindruck, dass ich euch zur Last falle.“
„Also das ist doch…“
„Oma, bitte. Du kannst nicht leugnen, dass ich euch nie etwas recht machen konnte. Immer habt ihr mich gemaßregelt. Ich kam mir vor wie ein kleines Kind, auch nach der Lehre noch. Das tat weh. Leider hatte ich keine Anstellung gefunden und musste hier wohnen bleiben. Ich hatte Angst, dass es zwischen uns eskalieren könnte, wenn wir noch länger unter einem Dach lebten. Deshalb bin ich nach Berlin gegangen. Immerhin konnte ich ja schon ganz gut deutsch.“
„Ja, weil deine Mutter, dieses Flittchen, einfach diesem deutschen Versager nachgelaufen war“, wirft Karen ein.
„Es ist, wie es ist, Oma. Jedenfalls sah ich in Berlin eine Chance. Es hat mich einfach dorthin gezogen. Ich kann es nicht näher beschreiben.“
„Ist ja auch egal“, meint Brian. „Erzähl weiter.“
„Als ich in Berlin ankam, da lag ich erst ein paar Tage unter Obdachlosen, Straßenhuren und Fixern in einem Bahnhof. Ich hatte kein Handy, um mich zu melden, und keine Münzen, um zu telefonieren. Ich brauchte dringend Geld und suchte mir einen Job. Wenn ich spontan bei einer Kneipe oder in einem Schnellrestaurant vorsprechen wollte, ging ich frühmorgens, wenn es noch einigermaßen still war in der Stadt, an einen Brunnen, wusch mich und zog mir ein paar Sachen an, die ich nur für diesen Zweck im Rucksack hatte. Ich hatte geglaubt, Berlin sei die Stadt aller Möglichkeiten, aber: Weit gefehlt. Es dauerte ein paar Wochen, bis ich endlich eine Stelle in einer Sexbar fand.“
Karen saugt hörbar die Luft ein. „Kind, du hast doch nicht etwa…“
„Nein, hab ich nicht, Oma. Ich war nur hinter der Theke beschäftigt, manchmal bis morgens um Sechs. Sie gaben mir ein bisschen Geld als Vorschuss, damit ich mir was zu essen kaufen konnte, und eine Kollegin nahm mich mit zu sich, damit ich ein Dach über dem Kopf hatte. Nach zwei Wochen gab sie mir bereits einen Schlüssel, weil wir unterschiedliche Schichten fuhren. Und dann…“ Sandras Gesicht wird bleich, die Lippen zittern. Nervös spielt sie mit den Fingern.
„Und dann wolltest du uns wohl anrufen“, flaxt Brian. Seine Ironie trifft Sandra, als sie mit fester Stimme die bittere Wahrheit verkünden möchte. Stattdessen ist sie nun weinerlich geprägt.
„Nein, Opa. Ich wurde von drei Männern vergewaltigt. Das war morgens um Vier. Sie machten sich abwechselnd über mich her, immer und immer wieder, und als sie endlich von mir ließen und ich um Hilfe schreien konnte, da stach einer von ihnen auf mich ein. Das bärtige Gesicht dieses Mannes werde ich niemals vergessen. Die anderen beiden sind allerdings verblasst. Man hat die Kerle wohl niemals geschnappt.“
Brian sitzt wie versteinert auf dem Sofa und rührt sich nicht.
Karen ist nicht minder entsetzt. „Mein Gott, mein Kind“, stößt sie schwach hervor. Sie möchte sich erheben, fällt aber in den Sessel zurück.
„Ja, Oma, so war das. Aber irgendjemand hat mich schreien gehört. Deshalb war schon bald ein Krankenwagen da, der mich ins Hospital brachte. Ich hatte sieben Stiche im Bauch und musste mehrmals operiert werden. Wie durch ein Wunder waren keine tödlichen Verletzungen dabei. Erst nach drei Monaten bin ich wieder entlassen worden. Aber ich war schwanger. Ein halbes Jahr später kam Jessica zur Welt. Das ist jetzt knapp neun Jahre her. Sie hat im Mai Geburtstag.“
Brian erhebt sich, um eine Kanne Tee zu kochen, und Karen ringt nach Fassung. Nach einer Minute fragt sie: „Und wie ging es dann weiter? Ohne Job, ohne Bleibe, aber mit einem Kind? Und das Krankenhaus war sicherlich auch nicht umsonst.“
„Die Krankenhausrechnung hat eine deutsche Hilfsorganisation für Verbrechensopfer übernommen“, erzählt Sandra. „Der Chefarzt selbst hatte sich darum gekümmert, weil er da jemanden gut kannte. Von denen bekam ich auch eine kleine Entschädigung, mit der ich mir für einige Monate ein Zimmer mieten und was zu essen kaufen konnte. Danach fand ich eine Stelle in einem Hotel als Zimmermädchen.“
„Und Jessica?“, fragt Karen. „Wo war denn das Kind, wenn du gearbeitet hast?“
„Ich musste Jessica in einem Heim abgeben und hielt mir die Option frei, sie baldmöglichst wieder dort abzuholen.“ Sandra weint fest, als sie ergänzt: „Das war das Schlimmste, was ich je getan habe. Das arme Kind. Ich sehe heute noch seinen traurigen Blick vor mir, als ich es der Schwester in den Arm legte, mich umdrehte und ging. Es war furchtbar.“
„Und wie lange war sie im Heim?“, fragt Karen. Als Sandra aber vornüber zusammensackt und sich dem Leid hingibt, hört sie auf, weiter zu bohren. Nicht nur, weil auch sie nun keine Stimme mehr herausbringt.
„Ich hatte immer eure Telefonnummer im Geldbeutel“, schluchzt Sandra nach einer Weile. „Ich hätte euch angerufen, ganz bestimmt. Ich dachte nur: Warte noch, bis es dir bessergeht, denn ich hätte es nicht übers Herz gebracht, euch was vorzumachen. Einfach zu sagen, es geht mir gut, das ging nicht. Und die Wahrheit sagen, das hätte ich auch nicht gekonnt. Dann kam die Vergewaltigung. Die Kerle haben mir meinen Geldbeutel abgenommen. Ich hatte eure Telefonnummer nicht mehr. Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus hatte ich sie vergessen. Was hätte ich denn tun sollen?“
Nach einigen Minuten kommt Brian mit dem Tee zurück. Er geht in die Küche, verteilt drei Tassen auf dem Tisch am Fenster und ruft die beiden Frauen hinzu. Karen schlurft herbei, in einer Hand den Stock, und auf der anderen Seite von Sandra gestützt. Sie schluchzt noch immer, während sie sich setzt. Sandra hat sich inzwischen wieder gefangen.
Brian füllt die Tassen, während er sagt: „Es tut mir so leid, Sandra. Es tut mir so leid.“ Seine Augen werden ganz klein. Eine Träne tritt hervor und platscht auf den Tisch. Er stellt die Kanne ab und setzt sich. „Ich habe dir die Schuld dafür gegeben, dass Karen immer schwächer wurde. Sie hatte sich solche Sorgen um dich gemacht, und in ihren Gram hat sie ihre ganze Lebenskraft gesteckt. Ich konnte förmlich zusehen, wie sie sich verzehrte.“ Er schnieft, zuppelt ein buntes Stofftuch aus der Hosentasche und putzt sich die Nase. Dann wiederholt er: „Es tut mir so leid.“
„Ist schon gut, Opa“, stammelt Sandra.
„Mir tut es auch leid“, fügt Karen hinzu. „Wir hätten uns nicht so benehmen dürfen, nicht, ohne die Wahrheit zu kennen. Ich möchte mich nicht für unser Benehmen entschuldigen, aber vielleicht verstehst du uns auch ein wenig, nach allem, was wir mit deiner Mutter durchgemacht haben.“
Читать дальше