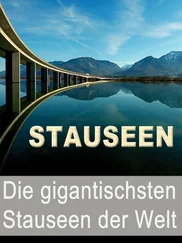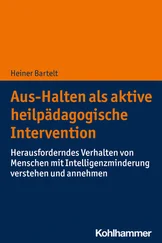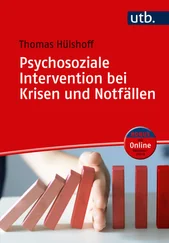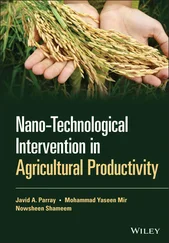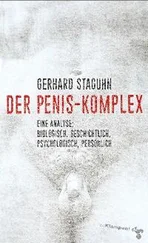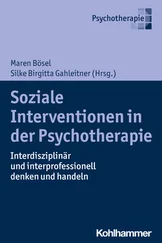Ulf OttosBeitrag befasst sich, wie derjenige von Azadeh Sharifi, mit der Inszenierung Mittelreich und fragt nach dem Erfolg dieser Intervention: Wie gelingt es der Arbeit, das Weißsein des (deutschsprachigen) Theaters zu artikulieren. Ausgehend von dieser Grundfrage nähert sich der zweite Abschnitt des Beitrags der Inszenierung aufführungsanalytisch an, beschreibt das Oszillieren der Wahrnehmung als dominante ästhetische Erfahrung und zeigt zugleich die Grenzen dieses Ansatzes auf. Daran anschließend nimmt der dritte Abschnitt das diskursive Geschehen in den Blick, das sich im Umfeld der Arbeit entfaltet hat und in diese selbst hineinragt. Dabei zeigt sich, dass es gerade die Verknüpfung von ästhetischen Erfahrungen und diskursiven Einordnungen ist, anhand derer die Bewertung und Bedeutung der Arbeit verhandelt werden. Mittelreich , so wird abschließend argumentiert, lässt sich mit STS und ANT als ein ästhetisches Experiment beschreiben, das den rassistischen Fundamenten des bürgerlichen Theaters zur Evidenz verhilft, und damit notwendig auch die Position der Wissenschaft herausfordert.
Marita Tataristellt noch grundsätzlicher die Frage nach dem Publikum an den Anfang, oder in ihren Worten, diejenige nach der Adressierung eines ›Wir‹, das kein Ganzes mehr formt. An die Diagnose einer Zeitenwende anknüpfend, wie sie sich bei Jean-Luc Nancy und Erich Hörl findet, argumentiert der Beitrag aus der ästhetischen Theorie heraus: Theater als westliche Kunst konstituiert sich seit der Neuzeit als affektive Gegenwart eines Gemeinsamen, das sonst nicht gegeben ist, und war daher immer auch als Vorwegnahme einer in die Zukunft projizierten Egalität zu verstehen. Als ein Exzess über das Wirkliche war Kunst traditionell Utopie und jede Intervention in die ästhetische Form entsprechend zugleich als politischer Eingriff zu begreifen. Gerade dieser tradierte Progress der ästhetischen Formen hat sich aus der Perspektive Tataris in unserer postfundamentalistischen Situation nach Schlingensief letztlich erledigt. Damit ist er zugleich einer primären Relationalität gewichen, die statt der Intervention in die ästhetische Form ein radikal anderes Denken eines neuen ›Wir‹ erfordert.
Kai van Eikelsbetont in seinem Beitrag schließlich die antagonistische Definition des Feldes und die Erklärung des Notstands, die dem Eingriff vorhergeht: Interventionen erscheinen daher als Ausnahmezustände, in denen das Politische temporär suspendiert wird, und stehen damit auch im Gegensatz zu einem Begriff der Kunst, der gerade im Aussetzen des Notwendigen seine Freiheit begründet. Es ist die Frage nach dem Management der Kontingenz, die dadurch in den Mittelpunkt rückt und die van Eikels an drei Beispielen – Cesare Pietroiustis Pensiero unico (2003), Paul Chans Waiting for Godot in New Orleans (2007) und Koki Tanakas Precarious Task #7: Try to keep conscious about a specific social issue, in this case ›anti-nuke‹, as long as possible while you are wearing yellow color (2013) – als eine Bewegung aus Ereignishaftigkeit (vor Ort) und ästhetischer Aneignung (im Medialen) analysiert. Als unverzichtbar für künstlerische Interventionen stellt sich dabei der abschließende Wechsel von der politischen Öffentlichkeit zur Kunstöffentlichkeit, der nicht zuletzt ökonomischen Imperativen gehorcht. So steht am Ende des Beitrags die große Frage, was die politische Intervention eigentlich an das politische Handeln zurückgibt.
Was die versammelten Beiträge über die theoretischen Positionen und ästhetischen Exempel hinaus vereint, ist eine Skepsis gegenüber den Narrativen der Intervention und das Bemühen, deren tatsächliche Politik in der detaillierten Analyse wie der historischen Perspektivierung zu erschließen. Das Buch eröffnet auf diese Weise Fragen, die in den oftmals erhitzten medialen Diskussionen weniger Raum finden: Steht etwa die Erinnerungspolitik, die eine Aktion wie Flüchtlinge fressen des Zentrums für Politische Schönheit aus dem Jahr 2016 thematisiert, nicht eigentlich in diametralem Gegensatz zum emanzipativen Projekt des postmigrantischen Theaters? Was bedeutet die Wiederkehr der heroischen Künstlerpersona, die mitunter an jenen von Schlingensief gern zitierten Fitzcarraldo (1982) erinnern lässt, der im Namen der Kunst und auf Kosten der Indios ein Schiff über einen Berg ziehen lässt? Wenn sich, wie Marx in Aufnahme eines Hegelschen Diktums behauptet hat, die Geschichte immer zweimal wiederholt, nämlich einmal als Tragödie und einmal als Komödie, in welcher Schleife befinden wir uns mit der ostentativen Verabschiedung von Postmoderne und Dekonstruktion? Schließlich, daran sei erinnert, ist die Performance in Kunst wie Theorie untrennbar mit einer queer-feministischen Tradition verbunden, die in Opposition zum patriarchalen Gestus des Linksintellektuellen auf den fehlenden Außenstandpunkt besteht und stattdessen die eigene Verwundbarkeit ins Spiel bringt – noch Schlingensief, der sich selbst auf den Container stellt, steht in dieser Tradition. Zu fragen wäre daher am Ende auch, ob es nicht doch wieder die Falschen sind, die hier die meiste Aufmerksamkeit erhalten? Und: Welche anderen, wichtigen Positionen bleiben hinter den ›lauteren‹ Stimmen weitgehend ungehört? Das Projekt der Dekolonialisierung klingt in vielen Beiträgen an, jenen zentralen Ort, der ihm im Kontext dieses Bandes eigentlich zukommen müsste, nimmt es allerdings nicht ein. Sichtbar wird in und mit diesem Band zuletzt also auch ein Desiderat, das seinerseits der Intervention harrt.
1Vgl. hierzu die berühmte These im Wortlaut: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretirt , es kömmt drauf an sie zu verändern .« Marx, Karl: »ad Feuerbach«, in: Ders./Engels, Friedrich: Gesamtausgabe (MEGA) , Abt. 4, Bd. 3, hrsg. v. der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, Berlin 1998, S. 19 – 21, hier S. 21.
2Zum sprachlichen Emblem eines mutigen Opponierens gegenüber politischen Missständen vgl. Zola, Émile: »J’accuse…! Lettre au Président de la République«, in: L’Aurore , 13. Januar 1898, o. S.
3Vgl. Blanchot, Maurice: Die Literatur und das Recht auf den Tod , Berlin 1982.
4Marcuse, Herbert: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft , Frankfurt a. M. 1998, S. 82.
5Adorno, Theodor W.: »Engagement«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. II. Noten zur Literatur , hrsg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1974, S. 409 – 430, hier S. 429.
6Kennedy, Jen/Mallory, Trista E./Szymanek, Angelique: Transnational perspectives on feminism and art, 1960-1985 , New York 2021.
7Vgl. hierzu Marchart, Oliver: Conflictual Aesthetics. Artistic Activism and the Public Sphere , Berlin 2019.
8Żmijewski, Artur: »Act for Art [Auszug]«, Homepage der Berlin Biennale: https://www.berlinbiennale.de/de/kataloge/1355/7-berlin-biennale-fr-zeitgenssische-politik(Zugriff am 20. April 2021).
9Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde , Frankfurt a. M. 1974, 72.
10Vgl. Wagner, Richard: »Das Kunstwerk der Zukunft« (1849), in: Sämtliche Schriften und Dichtungen , Bd. 3, Leipzig o. J., S. 42 – 177, hier S. 60.
11Vgl. Boal, Augusto: Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler , Frankfurt am Main 1989.
12Vgl. Santone, Jessia: »Marina Abramović’s ›Seven Easy Pieces‹: Critical Documentation Strategies for Preserving Art’s History«, in: Leonardo 41.2 (2008), S. 146 – 152.
13Vgl. Balme, Christopher: The Theatrical Public Sphere , Cambridge 2014.
14Vgl. Chance 2000 – Abschied von Deutschland (D, 2017, R: Kathrin Krottenthaler und Frieder Schlaich)
Читать дальше